„Die Männer mussten sich erst an uns Frauen gewöhnen“
Nur in Erfurt studierten in der DDR auch Frauen katholische Theologie. Über Leben und Wirken der Theologinnen klärt das neue Buch „Frauenporträts“ auf. Ein Bericht zum digitalen Eule-Autorinnengespräch.
Für den Abend des 9. Juli hatten wir gemeinsam mit der AG Religionsgeschichte der Europäischen Gesellschaft für theologische Forschung von Frauen (ESWTR) zu einer digitalen Lesung und Buchvorstellung von „Frauenporträts“ eingeladen. Drei Dutzend Teilnehmer:innen folgten der Einladung und erlebten einen spannenden und inspirierenden Ausflug in die jüngere Kirchengeschichte.
Die Buchautorinnen Marlen Bunzel und Weronika Vogel führten in das Buch und in die Geschichte des Theologiestudiums für Frauen in Erfurt ein. Unterbrochen wurden die Vortragsteile durch Lesungen aus den biographischen Selbstzeugnissen. Einige der Zeitzeuginnen, die den Autorinnen Interviews gegeben und Eindrücke in die Zeitgeschichte gewährt hatten, nahmen am digitalen Austausch teil und lasen zum Teil selbst aus ihren Erinnerungen vor. Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer:innen unter anderem darüber, ob es eine „Theologie der DDR“ gegeben hat – und wie es nach der Wiedervereinigung Deutschlands mit den Theologinnen und ihren Beiträgen zu Theologie und Kirche weiterging.
Marlen Bunzel hat selbst in Erfurt Theologie studiert und promoviert und war bis März 2025 Gastprofessorin für Biblische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Derzeit ist sie Senior Research Fellow am Institut für Bibelwissenschaft der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Weronika Vogel ist Masterstudentin der Theologie und Wirtschaft in Erfurt. Moderiert wurde das digitale Autorinnengespräch von Eule-Kolumnistin Carlotta Israel („Sektion F“).
„Ein geschützter Raum ‚Berufskatholikin‘ zu sein“
Nach dem 2. Weltkrieg hatte es in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der eben erst gegründeten DDR kein katholisches Priesterseminar mehr gegeben. Reisten in den ersten Nachkriegsjahren Studenten noch in die Seminare in den übrigen Besatzungszonen und die Bundesrepublik, wurde durch die sich manifestierende Teilung des Landes die Einrichtung neuer theologischer Ausbildungsstätten in der DDR nötig. Im Jahr 1952 wurde von den Bistümern auf dem Gebiet der DDR das Theologische Studium Erfurt als Ausbildungseinrichtung von künftigen Priestern und pastoralen Mitarbeitern gegründet, an der allerdings keine staatlich anerkannten Abschlüsse erworben werden konnten. Auf die prekäre Situation der katholischen Theologie weist schon die innovative Namensgebung der Ausbildungsstätte hin.
Acht Jahre später wurden erstmals Frauen zum Studium am Theologischen Studium Erfurt zugelassen. Die Frauen sollten eine vertiefte theologische Ausbildung für ihre Tätigkeiten im Gemeindedienst und in Kindergärten erhalten. Im Jahr 1962 wurde das Edith-Stein-Seminar für die angehenden Theologinnen eingerichtet. Die Studentinnen waren als Gasthörerinnen eingeschrieben, um die katholische Priesterausbildung nicht zu gefährden. Der Unterricht wurde anfangs sogar in den Zimmern der Studentinnen erteilt.
Der Studiengang war zunächst auf drei Jahre hin ausgelegt und schloss sich an die bereits zuvor absolvierte kirchliche Ausbildung an. Die Studentinnen waren also häufig älter und lebenserfahrerener als ihre männlichen Kommilitonen. Ans Seminar wurden sie von ihren jeweiligen Ortsbischöfen delegiert, mussten außerdem Abitur und Lateinvorkenntnisse mitbringen. Zwischen 1962 und 1990 studierten insgesamt 56 Frauen in Erfurt katholische Theologie, die meisten von ihnen in den 1980er Jahren. Die prekären Umstände am Seminar, divergierende Ansprüche der Bistümer und biographische Unterschiede sorgten dafür, dass die Studentinnen unterschiedlich lang und intensiv am Seminar studieren konnten. Im Buch „Frauenporträts“ werden die Studien- und Lebenswege von 16 der Theologinnen (mit Selbstzeugnissen) nachgezeichnet.

Blick auf den Erfurter Dom und die Severikirche (Foto: Eremeev/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
„Wir waren auf einmal dran“
Bei aller Unterschiedlichkeit der Studien- und Lebenswege gibt es doch gemeinsame Erfahrungen, die von den Frauen gemacht wurden. Über die Möglichkeit, überhaupt Theologie studieren zu dürfen, waren sie (ihren Bischöfen) sehr dankbar. Das Seminar wurde zu einem kleinen Freiheitsort inmitten einer Gesellschaft, die stark entkirchlicht wurde. Für die katholische Diaspora in der DDR war die Erfurter Theologie ein wichtiger Lebensfaden.
Beim zunehmend gemeinsamen Theologiestudium mit den männlichen Kommilitonen wurde jedoch auch deutlich, wie das theologische Arbeiten innerkatholisch aufgrund des Geschlechts differenziert betrachtet wurde. Dabei erinnern die Frauen das Wirken ihrer Professoren und Dozenten als sehr unterstützend, während das Studium mit „weniger fleißigen, aber berufenen“ Männern auch in der Erinnerung Anlass zum Grübeln gibt. Die Theologinnen wirkten nach ihrem Studium in Erfurt in den katholischen Gemeinden, in der kirchlichen Arbeit mit Kindern, der Erwachsenenbildung, auch publizistisch und in Ausnahmefällen akademisch-theologisch. Angebote, selbst als Professorin tätig zu werden, schlugen zwei Absolventinnen hingegen aus.
Der im Frühjahr 2025, kurz vor Veröffentlichung des Buches, verstorbenen Theologie-Pionierin Jutta Brutscheck, rief Weronika Vogel auf dem Blog der Katholisch-Theologischen Fakultät Erfurt nach, was für Leben und Wirken zahlreicher Theologiestudentinnen in Erfurt gilt: „Die Jahre ihres Studiums in Erfurt waren für sie mehr als eine akademische Ausbildung, sie waren ein Ort der Berufung und Bestärkung. In einer Zeit des Umbruchs bot ihr das Studium die Freiheit, theologisch zu denken – und später, andere in diesen Denkraum einzuladen.“ Brutschek war die erste und einzige promovierte katholische Theologin der DDR. Promoviert wurde sie an der Universität Krakau, weil ihr dies im Unterschied zu ihren männlichen Kollegen an einer päpstlichen Hochschule in Rom nicht gestattet war.
Aus den biographischen Schilderungen der Frauen geht eindrücklich hervor, welchen großen Schatz sich die Kirche in der DDR an ihnen erworben hat, wie sie „den theologischen Grundwasserspiegel“ in ihren Bistümern angehoben haben. Immer wieder geraten die Frauen noch heute, im Nachdenken über ihre Vergangenheit, ins Theologisieren. Die Freude am gläubigen Denken und nachdenklichen Glauben ist mit beiden Händen zu fassen. Nach der Wiedervereinigung waren die Absolventinnen des Edith-Stein-Seminars bei der Einführung des Religionsunterrichts in den neuen Bundesländern, an kirchlichen Akademien und in den Bildungsressorts der Bistümer – auch in den alten Bundesländern – gefragt. Regina Freitag erinnert: „Wir waren auf einmal dran!“
Gesucht wurde im wiedervereinigten Deutschland nach Frauen, die psychologisches und theologisches Wissen mitbrachten und nicht sozialistisch geprägt waren. Dass die Abschlüsse, die von den Frauen in Erfurt erworben wurden, von Seiten beider deutscher Staaten nicht anerkannt waren, stellte wenngleich nicht immer eine Hürde so doch einen Wermutstropfen dar. Manche Theologin absolvierte „nach der Wende“ noch Kurse, um die staatliche Anerkennung „nachzuholen“.
„Als kleiner Teil der Geschichte aufgehoben ins Gottes Händen“
Im Austausch mit den Zeitzeuginnen beim digitalen Autorinnengespräch und bei der Lektüre von „Frauenporträts“ wird deutlich, wie notwendig und wertvoll die Erinnerungsarbeit zur Theologiegeschichte der DDR ist. Weil sich doch so viel geändert hat im wiedervereinigten Deutschland und in den über drei Jahrzehnten seit dem Ende der DDR, das heute studierenden Theolog:innen ohne die Berichte ihrer Vorgängerinnen kaum verständlich wird. Und auch, weil sich manche Probleme und Herausforderungen in Gesellschaft und Kirche bis heute erhalten haben, denen auch die Studentinnen am Edith-Stein-Seminar schon gegenüberstanden.
Da wäre zum Beispiel das „ungeschriebene Gesetz des Zölibats für die Frau“, dem sich die Studentinnen auch dann zu unterwerfen hatten, wenn sie keine Ordensschwestern waren. Partnerschaft, Eheschließung und Familiengründung werden von ihnen zum Teil als schwieriger Bruch der Loyalität mit den kirchlichen Autoritäten erinnert, die ihnen das Theologiestudium erst ermöglicht hatten. Wer fühlt sich angesichts dieser Zeitgeschichten nicht an gegenwärtige Auseinandersetzung um die Übergriffigkeit katholischer Theologie und Kirche ins Privatleben sowohl auf akademischen Karrierepfaden als auch kirchlichen Berufswegen erinnert?
Gab es eine „Theologie der DDR“? Wenn es sie gegeben haben sollte, dann wurde sie mit der Wiedervereinigung „weggewischt“, schildern die Zeitzeuginnen. Nicht alle ihre Erfahrungen waren nach dem Ende der DDR gleich viel wert. Viele der Studentinnen und Absolventinnen engagierten sich während des Umbruchs in der DDR, „doch war da auch ein Ahnen, das jetzt vieles schwer wird“. Mit der DDR ging auch der Sonderweg in der TheologInnen-Ausbildung in Erfurt zu Ende. Das Glockenläuten der Gloriosa im Erfurter Dom anlässlich der Wiedervereinigung wird in der Erinnerung von Ulrike Hannak zum Zeichen von Ende und Neubeginn. Die Kleine Schwester Jesu fühlt sich in diesem Moment, „als kleiner Teil der Geschichte aufgehoben ins Gottes Händen“.
Marlen Bunzel und Weronika Vogel ist mit ihrem Buch über die katholischen Theologinnen in der DDR ein wichtiger Beitrag zur kirchlichen Zeitgeschichte gelungen. Angesichts des um sich greifenden Niedergangs an den theologischen Ausbildungsstätten in Deutschland, fragt man sich unweigerlich, ob es nicht längst an der Zeit ist, auch anderen Konstellationen, die wie das Erfurter Frauenstudium in der Vergessenheit zu versinken drohen, auf solche Weise ein Denkmal zu setzen. Wer wird in drei Jahrzehnten noch wissen, wie es einmal war in Jena, Halle, Leipzig oder Greifswald Theologie zu studieren?
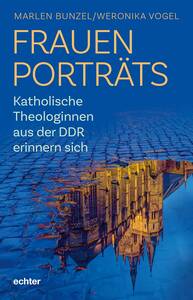 Marlen Bunzel, Weronika Vogel
Marlen Bunzel, Weronika Vogel
Frauenporträts
Katholische Theologinnen aus der DDR erinnern sich
Echter Verlag
200 Seiten
19,90 €
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.
