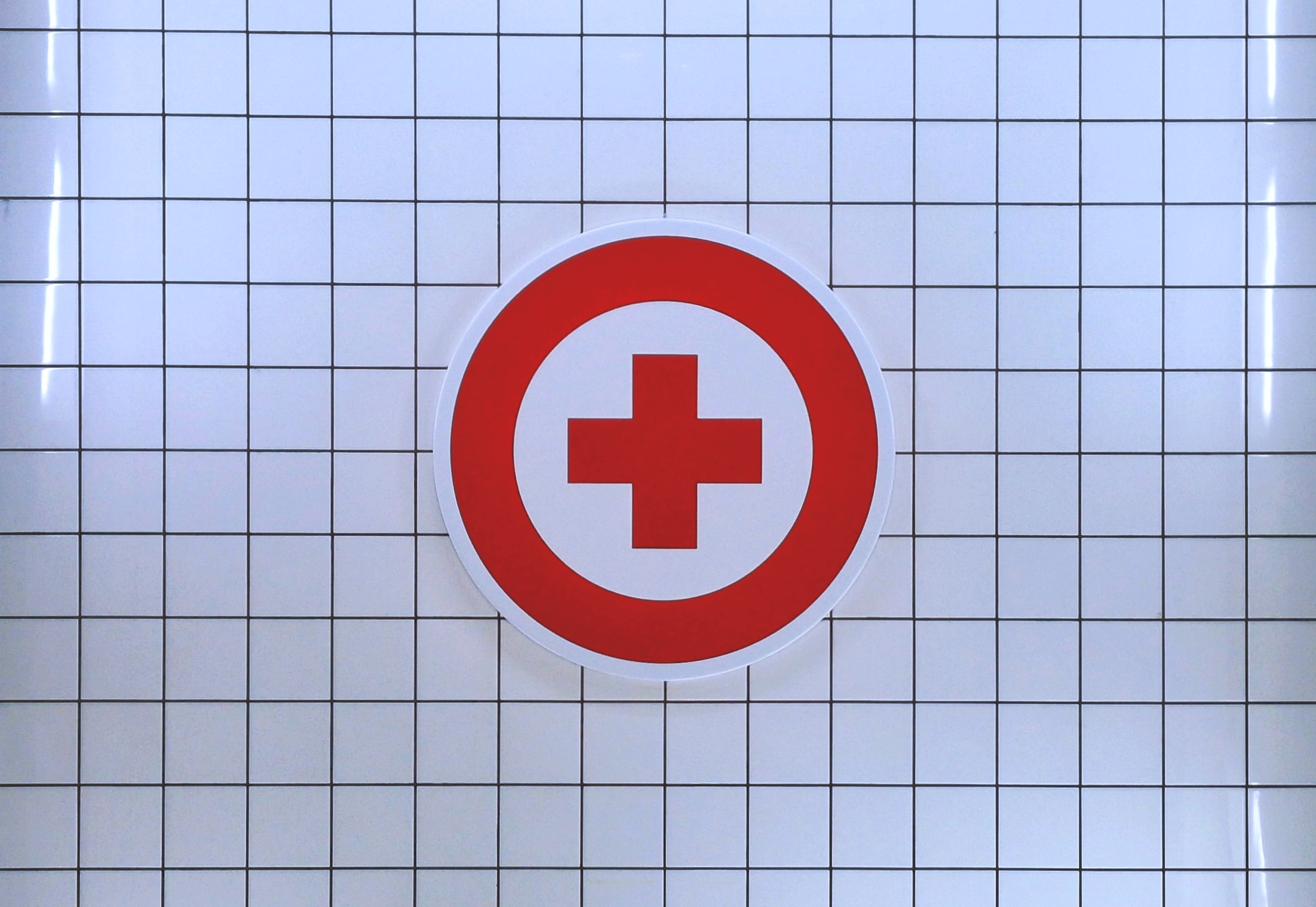
Wie wir Menschenleben abwägen
Was ist eine Triage? Kann man Menschenleben überhaupt gegeneinander abwägen? Über den Ernstfall christlicher Ethik:
Seit einigen Tagen wird in den Nachrichten über Triagen gesprochen. Ein Begriff, der vielen allenfalls aus Katastrophen-Szenarien in US-amerikanischen Fernsehserien bekannt war. Das Konzept dahinter ist außerhalb der Medizin nahezu unbekannt. Darum ranken sich um Triagen in den vergangenen Tagen auch Gerüchte: Werden Patient*innen anderen Kranken vorgezogen?
Was ist eine Triage?
Bei einer Triage in Notfällen werden Patienten in vier Gruppen eingeteilt, die ihre Priorität bei der Versorgung regeln. Mittlerweile ist das einigermaßen bekannt, zumal in Italien so vorgegangen werden muss, und wir auch in Deutschland noch nicht sicher sein können, dass uns dies nicht auch droht. Von dieser Art der Triage zu unterscheiden ist die Ersteinschätzung und Einteilung von Patient*innen im Normalbetrieb einer Notaufnahme, für die sich manchmal auch der Begriff „Triage“ eingebürgert hat.
Notfall-Triagen werden eingerichtet, wenn nicht genug Ressourcen – medizinische Fachkräfte, Medikamente oder Gerätschaften – zur Verfügung stehen, um in einer Notsituation alle Menschen zu versorgen. Das kann in Katastrophenfällen wie Bränden oder Explosionen von Gebäuden nötig werden. Bei Corona geht es hauptsächlich darum, dass es zu wenige Atemgeräte gibt, um alle Menschen, die beatmet werden müssten, auch beatmen zu können.
Dann wird priorisiert und Menschen, die trotz Beatmung eine sehr geringe Überlebenschance hätten, werden zurückgestellt. Schlicht gesagt: Sie werden sterben. Hier liegt auch der Hauptunterschied zwischen der Ersteinschätzung im Normalbetrieb der Notaufnahme und der Notfall-Triage: Im ersten Fall gibt es die Gruppe derjenigen nicht, die nur palliativ behandelt und zum Sterben eingeteilt werden.
Die Einteilung in einer Triage folgt natürlich Kriterien, die nicht willkürlich formuliert werden dürfen. An den Kriterien der Triage in Italien wurde und wird Kritik geübt und die deutschsprachigen Fachgesellschaften für Ethik bemühen sich um deren Analyse und eventuelle Hinweise für die Rechtfertigung von Kriterien. Das ist sinnvoll, denn es ist klar, dass solche Entscheidungen im Ernstfall schnell getroffen werden müssen und Ärzt*innen kommunizierbare Kriterien benötigen, die sie in der Praxis anwenden können. Hier kommen Ethik und Rechtswissenschaft ins Spiel.
Leerstelle der theologischen Ethik
In der theologischen Ethik, die ich studiert und in der ich auch Lehrveranstaltungen gegeben habe, spielen Begriff und Konzept der Triage keine große Rolle. In der philosophischen Ethik gibt es einzelne Veröffentlichungen und Debatten zu dem Thema. Interessanterweise enthalten sich viele Lehrbücher zur medizinischen Ethik dieser Fragestellung. Fragen der Abwägung von Menschenleben werden im Standard-Betrieb der Ethik zumeist abstrakt in Form von Dilemmageschichten diskutiert.
Das Ziel solcher Gedankenexperimente ist zumeist nicht, Sensibilität für medizinische Grenzsituationen zu wecken, sondern auf Probleme mancher prinzipienethischen Überlegungen aufmerksam zu machen. Das Trolley-Beispiel ist dafür einschlägig. An ihm kann dann in der Lehre schön gezeigt werden, dass ein solches utilitaristisches Denken, dem man wohl ganz intuitiv folgen würde, falsch zu sein scheint.
Aber mit der Frage nach der Triage und den Überlegungen, wie dort entschieden werden kann, möchte man sich in der theologischen Ethik nicht unbedingt näher beschäftigen – jedenfalls wenn man nicht, wie jetzt gerade, mit dem Rücken zur Wand steht. Das liegt an einer Grundentscheidung evangelischer Ethik, die sich explizit und implizit durch alle medizinethischen Debatten zieht: Das Leben eines Menschen ist das höchste aller Güter.
Das ist im Prinzip auch richtig. Der Wert des Lebens wird so hoch geschätzt, dass selbst der einzelne Mensch nicht über sein Sterben entscheiden soll, denn er darf über sein Leben nicht verfügen. Das führt zu einer anderen, für die Bewertung einer Triage wesentlichen Grundentscheidung: Wenn das Leben so hoch gehängt wird, dann ist es auch nicht gegen andere Leben abzuwägen. Und dann lässt sich in einer Triage-Situation nichts Sachgemäßes von einer christlichen Ethik aus beitragen.
Man kann natürlich das – diesmal Wirklichkeit gewordene – Dilemma betrauern, den Ärzt*innen die Entscheidung überlassen und die ganze Situation der Seelsorge anempfehlen, aber man bleibt doch dabei, dass es sich in moralischer Perspektive verbietet, Menschenleben abzuwägen. Dies deckt sich mit einem überwältigenden Großteil der kirchlichen Verlautbarungen zu medizinethischen Fragen, abweichend davon vielleicht nur die Veröffentlichung zu Pränataldiagnostik 2018*. Diese Position wird in schnöder Regelmäßigkeit und mit viel Pathos vorgetragen, gerne unter Verweis auf die Gottesebenbildlichkeit.
Wir haben uns längst entschieden
Vor diesem Hintergrund ist eine andere Beobachtung umso erstaunlicher: Uns schockiert die Vorstellung, dass eine Triage eingerichtet werden muss, wir haben aber gleichzeitig deutlich weniger Probleme damit, dass Menschenleben durch andere Maßnahmen gefährdet werden, die gegen die Verbreitung des neuen Corona-Virus in Anschlag gebracht werden. Natürlich steht eine Abwägung in Form einer Triage uns klarer vor Augen: Das entscheidende Handeln ist direkt und die Kausalketten sind deutlich wahrnehmbar. Aber wir dürfen nicht so tun, als stünde uns die Frage der Abwägung von Menschenleben erst mit Triagen bevor.
Maßnahmen wie Ausgangssperren und Kontaktverbote sind für den Großteil der Menschen richtig, wichtig und hilfreich. Aber es gibt auch Menschen, für die diese lebensgefährlich sind. Dazu zählen arme Menschen, die auf Tafeln angewiesen sind, die schließen mussten. Dazu zählen Menschen, die unter häuslicher Gewalt leiden. Dazu zählen Menschen, die in psychologischer und psychiatrischer Therapie stehen und deren Therapien sich eben nicht mal einfach telefonisch durchführen lassen.
Dazu zählen aber auch Menschen, für die soziale Kontakte lebenswichtig sind, und die diese nicht einfach durch Skype oder WhatsApp ersetzen können. Ältere Menschen, deren soziales Leben z.B. im Besuch des Marktes am Wochenende oder im Stammtisch am Mittwoch oder auch im Kirchgang besteht. Und in dieser Aufzählung sind die Menschen an den Grenzen Europas noch gar nicht bedacht, die vom Virus genauso bedroht sind wie wir, aber in ihrer Misere belassen werden.
Für diese und andere Menschen stimmt einfach nicht, dass es sich bei den Ausgangssperren und Kontaktverboten um eine „zeitlich beschränkte Solidaritätsaktion“ handelt. Für sie sind die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona schlicht das Gegenteil von Solidarität. Man macht es sich zu einfach, wenn man behauptet, dass sich Einschränkungen für alle Menschen in diesem Land und erst recht anderswo kompensieren lassen.
Harte Realität
Die Tränen, die wir über die Grausamkeit von Triagen vergießen, sind jedenfalls solange Krokodilstränen, solange ein „Whatever it takes“ manchen Leuten mehr nimmt, als in Ruhe ein Eis essen gehen zu können. Es ist das eine, dass die evangelischen Kirchen und der gute Großteil aller Menschen, die dort Verantwortung tragen, die staatlicherseits verordneten Vorsichtsmaßnahmen und Handlungsanweisungen loben. Dass die Schattenseiten bisher in den kirchlichen und theologischen Reaktionen auf die Corona-Krise kaum wahrnehmbaren Raum einnehmen, ist das andere.
Stattdessen sollten wir ehrlich sein: Der Maßstab, den wir angelegt haben, ist ein ganz schlichter, aber auch der einzige, der irgendwie rechtfertigbar ist: Das Wohl der Vielen schlägt das Wohl des Einzelnen. Danach wird gehandelt. Alles andere wäre auch barbarisch, denn nur in diesem größeren Maßstab sind solche Entscheidungen vertretbar. Nur vor diesem Hintergrund teilen wir Menschen nicht durch menschliche Maßstäbe in lebenswertes und weniger lebenswertes Leben ein. Von hier aus lohnt es sich, weiter theologisch nachzudenken.
* Bei der Veröffentlichung der Stellungnahme habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Vorsitzenden der Kammer für öffentliche Verantwortung der EKD, Prof. Reiner Anselm, einzelne redaktionelle Aufgaben übernommen.
