
„Denn alle wissen Gott, die ihren Atem wissen“
Sabrina Hoppe mag keine Naturgedichte. In Christian Lehnerts siebten Gedichtband „Cherubinischer Staub“ trifft sie auf aktuelle Theopoesie.
Ich mag keine Naturgedichte. Eigentlich mag ich vor allem keine Naturbeschreibungen. Sie langweilen mich. Sie halten mich vom Wesentlichen ab. Wenn ich Bücher lese, in denen die Farbe der Weidenkätzchen in ihrem Changieren zwischen Grau und Halbgrau über mehr als zwei Atemzüge lang beschrieben wird, lege ich sie beiseite.
Aber ich mag den Raum, der entsteht, wenn Menschen die Wirklichkeit ergreifen, ohne sie bis ins Letzte zu beschreiben. Ich mag den Atem, den ich anhalte, wenn das Gedachte sich in Worte bricht. Wenn der Geschmack für das, was in mir fehlt und fehlt, über meine Lippen perlt. P-E-R-L-T. Weil jedes einzelne Wort sein Werden rechtfertigt und damit das Werden der Welt beschreibt. Weil dann das, was groß ist und herrlich und prunkvoll zu Staub zerfällt und der Staub sich über das legt, was in ihm aufgegangen ist.
Aber egal: Von Christian Lehnert würde ich sowieso alles lesen. Dank ihm sehe ich in der Liturgie des Gottesdienstes keine verkümmerten Restbestände mehr, sondern meine „Fährte im Schnee“. Dank ihm sind mir die Nähe und die Ferne Gottes zu den Drahtseilakten des Gottesdienstes geworden. Die theologische Stringenz und die erdfarbene Frömmigkeit des Lyrikers und Pfarrers sind mir seit seinem letzten Werk „Der Gott in einer Nuß“ vertraut und ich bin versucht, seine neu erschienene Gedichtsammlung „Cherubinischer Staub“ schon von vornherein zu loben.
Und tatsächlich, vieles erkenne ich wieder: Lehnerts Wurzeln in der Sprache und Vorstellungswelt der christlichen Mystik sind wie in all seinen Texten auch im „Cherubinischen Staub“ greifbar. Wie bereits beim „Gott in einer Nuß“ leiht er sich für seinen Titel die Worte des zum Katholizismus konvertierten Barockdichters Angelus Silesius (1624-1677), der in seinem „Cherubinischen Wandersmann“ zweizeilige Aphorismen versammelte, die wiederum von den Mystikern Meister Eckhart und Johannes vom Kreuz inspiriert waren.
Fast als wolle er sich langsam in seine Gattung einschreiben, drängen sich übrigens auch Lehnerts Gedanken zumindest zu Beginn noch in Zweizeiler. Und doch sprengen Lehnerts Worte bald diesen gestrengen Takt. Versucht er sich zu Beginn der Sammlung noch an einem „Wörterbuch der natürlichen Erscheinungen“, in dem er nahe am Wasser, an den Blättern, am Torf bleibt und sie schreibend ins Neue übersetzt, greifen seine Worte im Verlauf des Bandes mehr und mehr auf das Wesen des suchenden, glaubenden und im Nebel geborgenen Menschen über:
„Glaubende gehen nach Sicht oder nach Fühlung im Haar. (…) So aber sind wir Fremde, still im Nebel geborgen, immer nur einen Schritt neben dem schimmernden Grat.“ (Die Ausgewanderten)Der „Cherubinische Staub“ des Titels offenbart das Ergreifen-Wollen und Erkennen-lassen von Lehnerts Theopoesie. Das Paradoxon von den himmlischen Cherubinen, die in der Bibel den Thron Gottes tragen und Zeugen und Garanten seiner Herrlichkeit sind und dem Staub, in den alles Atmende irgendwann zerfällt, greifen wiederum einen von Christian Lehnerts elementaren Gedanken auf: Das Fremde, Herrliche und Anbetungswürdige ist das, was uns so nahe kommt, das es uns den Atem raubt. Und gleichzeitig gehen wir in ihm – der Gottheit – auf, wenn wir sie ergreifen wollen – der Gott ergreift uns, macht unser Werden zu seinem Sein:
„So laß doch ein den Hauch, verschließ dich nicht im Bleiben! Laß still den Gott in dir sein Wuchs und Strömung treiben!“ (Vanitas)Nachdem ich in den beiden ersten Kapiteln „Stille ohne Maß“ und „Von der Unruhe“ noch viele konkrete Geschichten und Miniaturen gefunden habe – von den Wundmalen am Körper Jesu, vom Ostermorgen, ja sogar drei Porträts der drei „Magier“ aus dem Morgenland – so erfüllt der „Cherubinische Staub“ in seinem letzten Kapitel, den „Baumgesprächen“ endlich noch mein Vorurteil der Naturpoesie. Das Rauschen des „Dickichts der Buchen“, das Singen der Wildkirschen und das monotone Rattern der „Eschenkolonne“ – meinen Gedanken fällt es schwer, noch länger zuzuhören. Und ich blättere zurück zu den Worten, wegen derer allein ich dieses Buch kaufen würde:
„Der Tod erfasst dich nicht. Du selber lässt ihn fassen. Was immer bleiben soll, ist unentwegt ein Lassen.“ (Armut)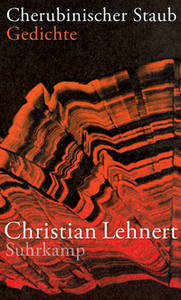 Cherubinischer Staub
Cherubinischer Staub
Gedichte
Christian Lehnert
Suhrkamp
112 Seiten
20 €
