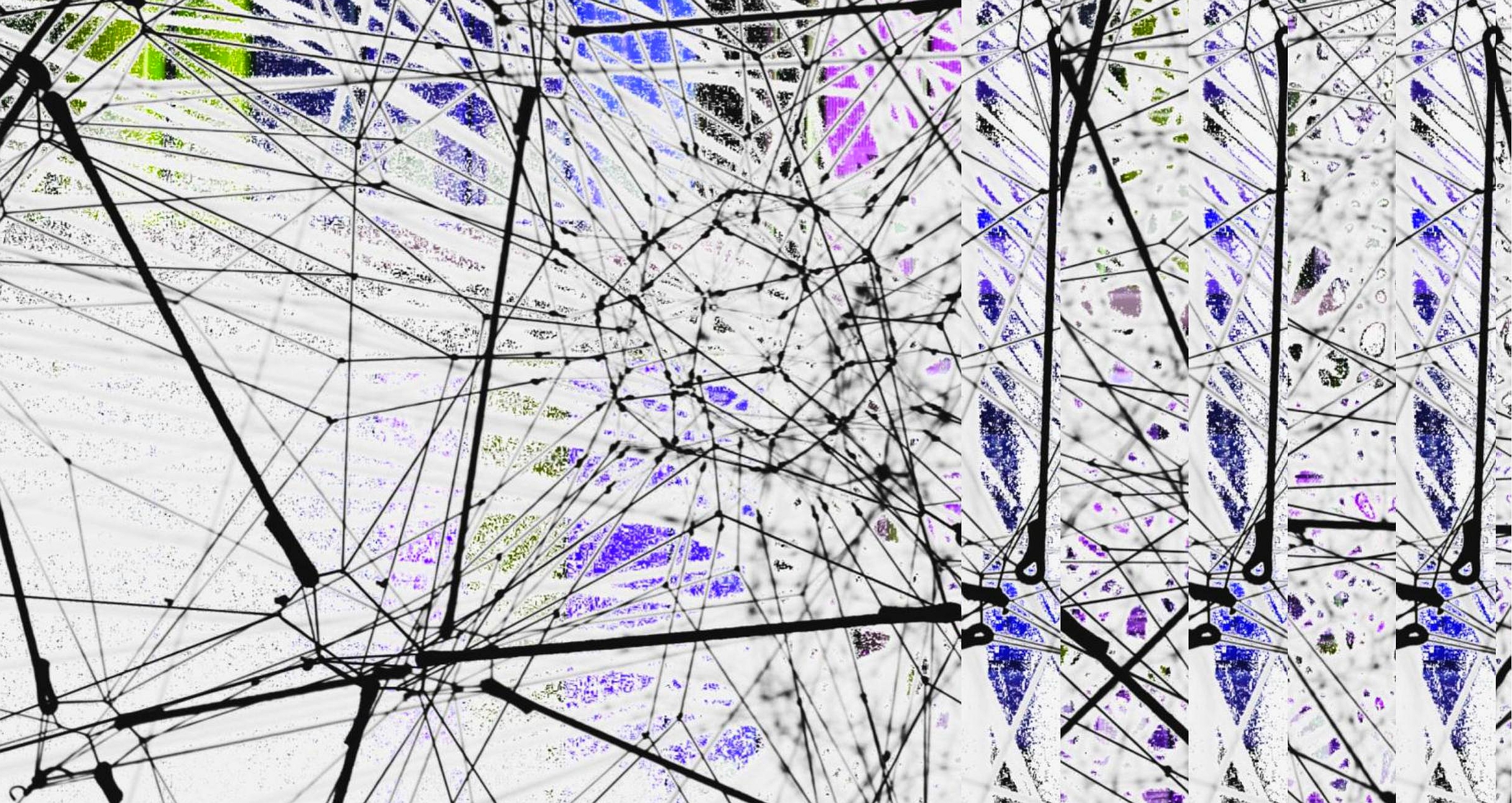
Was ist Citizen Theology?
Unter dem Schlagwort Citizen Theology arbeiten drei junge Theolog*innen an einem neuen Konzept für Theologie im digitalen Zeitalter. Was hat es damit auf sich?
Eule: Was ist Citizen Theology?
Thomas: „Citizen Theology“ ist unsere Formulierung, die sich an den bekannteren Begriff der Citizen Science, also der Bürgerwissenschaft, anlehnt. Und ähnlich wie dort geht es uns bei Citizen Theology darum, Nicht-Expert*innen stärker in theologische Forschung einzubinden und dafür insbesondere digitale Medien zu nutzen. Citizen Theology steht damit erst mal für einen neuen Forschungsstil, ohne ein ganz bestimmtes inhaltliches Programm vorzusehen.
Wie die unterschiedlichen Konkretionen aussehen werden, wie Citizen Theology konkret umzusetzen ist, diese Frage ist selbst Teil der experimentellen Dimension des Ansatzes. Es gibt ein paar Grundkonstanten bei der Herangehensweise, dann aber vor allem die Bereitschaft, Theologie als Experiment zu treiben.
Benedikt: Der Punkt ist auch, dass man ja ganz offensichtlich sieht, wie sich nicht nur wissenschaftliche Forschung im Speziellen, sondern auch alltägliche Kommunikation verändert – und die religiöse und implizit theologische ist da keine Ausnahme. Diskussionen werden über soziale Medien wieder pointierter, viele Leute wollen sich sehr schnell zu Dingen äußern. Das kann natürlich auch ganz ungute Dynamiken begünstigen.

Benedikt Friedrich, Foto: Friederike Nordholt
Aber: Dass sich eben viele Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen auf genau diese Kommunikationsformen einlassen, zeigt ja, wie viele daran Spaß haben, laut zu denken. Und wir sehen darin grundsätzlich ein großes Potential an Erkenntnisgewinn, wenn sich einerseits mehr und andererseits andere Leute beteiligen als in klassischen Diskursformen der akademischen Theologie.
Hanna: Mit der Beteiligung sind mehrere Anliegen verbunden. Werte wie Partizipation, Befähigung und Demokratisierung schwingen da mit. Kreuzestheologisch ist für uns eine grundlegende Einsicht, dass wer und was Gott ist, sich vermutlich nicht in der „Macht und Weisheit der Welt“ zeigen wird, also auch nicht in den Privilegien und Hierarchien akademischer Elfenbeintürme besonders gut erforschbar ist. Wir brauchen darum für die Theologie die Gottes-, Glaubens- und Lebenserfahrungen derer, die in der Betrachtung nicht im Zentrum stehen.

Hanna Reichel, Foto: Kevin Birch
Auch ekklesiologisch ist uns wichtig, dass Theologie eine Funktion des Glaubens des kirchlichen Gesamtleibes ist und nur in enger Rückkopplung mit gelebtem Glauben in seinen verschiedenen Formen des Glaubens betrieben werden kann. Mindestens implizit konstruiert jede*r, die/der glaubt und lebt, dauernd Theologie, das kann also nicht ausgelagert werden an einzelne “Glieder”.
Eule: Wen meint ihr mit den Bürger*innen, die jetzt im digitalen Raum Theologie treiben (sollen)?

Thomas Renkert, Foto: privat
Hanna: Das ist eine sehr gute Frage. Negativ gesehen kommen wir erstmal von dem Eindruck her, dass unser etabliertes Wissenschaftssystem das eben sehr eng beschränkt, und das wollen wir ein Stück weit aufbrechen. Ich selbst unterrichte in einem akademischen Kontext, in dem es schon eine gewisse Öffnung darstellt, Studierende als ernsthaft Theologie-Produzierende statt nur als Wissensrezipient*innen in den Blick zu nehmen.
Das mag jetzt wenig revolutionär erscheinen: Studierende sind immerhin schon selbst Teil des Wissenschaftssystems, aber die Rollen, die ihnen darin zugewiesen werden, sind eben oft sehr begrenzt und wenig aktiv. Schon da verschenkt die akademische Theologie enormes Potential. Natürlich haben Studierende vielleicht (noch) nicht immer den Überblick über spezifische Forschungsdebatten oder historische Hintergründe, aber sie haben meist ein sehr feines Sensorium für Fragen der Relevanz, eine hohe Ernsthaftigkeit und eine ausgeprägte Originalität – und das ist echte Expertise, von der die akademische Theologie nur profitieren kann.
Und über den akademischen Kontext hinaus stellen wir einfach fest: Wir müssen gar nichts erfinden, sondern das passiert sowieso dauernd, dass Leute, die nicht spezifisch darin ausgebildet sind und nicht direkt dafür bezahlt werden, über theologische Fragen und religiöse Themen reflektieren und diskutieren. Das gilt in der analogen Welt natürlich auch: in Kirchengemeinden und Hauskreisen, an Stammtischen und beim Abendgebet mit den eigenen Kindern.
Aber man sieht es auch auf Twitter, in Blogs und Podcasts. Dort ist es eigentlich relativ leicht, niedrigschwelliger mit anderen zu interagieren. Wir wollen also einerseits als „professionelle“ Theolog*innen überhaupt erst mal registrieren und dann ernst nehmen, was da sowieso passiert, und dann digitale Medien verwenden, um solche vorhandenen theologischen Räume auch als Ressourcen für die akademische Theologie nutzbar zu machen und den Austausch enger und produktiv zu gestalten.
Benedikt: Ganz konkret haben wir z.B. im Moment Spaß daran, auf Twitter immer wieder Posts mit diesem Hashtag #citizentheology zu kennzeichnen, die man manchmal mehr, manchmal vielleicht auch gar nicht in diesem Zusammenhang sehen würde. Das heißt dann soviel wie: Wow — Fundstück! Hier gibt’s z.B. ‘nen Post, Blogeintrag, oder Link, der einen toten Winkel in unserer akademischen Blase ausleuchtet. Oder hier wird die Expertise von „citizens“ theologisch ernst genommen. Oder hier werden neue Methoden oder Gedankenspiele unternommen, die andere Erfahrungen für die theologische Reflexion zugänglich machen.
Thomas: Das Interessante ist, dass das Thema Religion und quasi- oder pseudo-theologische Argumente im öffentlichen – und gerade digitalen – Raum recht häufig auftauchen und mit zu den intensiv diskutiertesten zählen. Auf Wikipedia zum Beispiel finden um den „Jesus“-Artikel regelrechte „edit wars“ statt, d.h. verschiedene Menschen versuchen dauernd, den Artikel in unterschiedliche Richtung zu ändern, ohne dass es zu einer Einigung kommt. Es scheint kaum User zu geben, die nicht an irgendeiner Stelle eine Meinung zu theologischen Fragen hätten.
Die Kehrseite der Medaille ist, dass moderne „public intellectuals“, also Expert*innen, die sich in öffentlich-digitale Debatten einklinken, eher in anderen Fachbereichen zu finden sind. Ausgebildete Theolog*innen melden sich (noch) recht wenig zu Wort, dabei wäre es reizvoll und wichtig, zu möglichst plural besetzten Diskursen zu kommen, bei denen auch ein guter Expertisen-Mix eine Rolle spielt. Wir suchen daher nach Möglichkeiten, interessierte Nicht-Expert*innen an einem theologischen Austausch, der über „das glaub ich nicht“ oder „Gott will, dass“ hinausgeht, zu beteiligen.
Benedikt: Das ist auch deshalb wichtig, weil wir ja im Protestantismus ja eigentlich von einem Priestertum aller Gläubigen sprechen. Und das heißt unserer Meinung nach auch, dass das Nachdenken und Argumentieren nicht ausschließlich Aufgabe einer speziell dafür ausgebildeten Gruppe ist. Wenn das nämlich nur in theologischen Fakultäten passieren würde, hätten wir eigentlich genau das Problem, wogegen die Reformation auf anderer Ebene angegangen ist: Die Auslagerung und Konzentration von religiöser und theologischer Kompetenz und Deutungsmacht an einige wenige Kleriker und monastische Zentren. Das ist ja Gott sei Dank de facto nicht so!
Aber die wissenschaftliche Theologie pflegt dieses Image leider zu oft. Und um die Vorstellung von wissenschaftlicher Theologie als Kompetenzzentrum, das über Bibeltexte, die Kirchenhistorie und über die kirchliche und religiöse Praxis Deutungshoheit beanspruchen, nicht zu verfestigen, halten wir es für notwendig, gezielt auf die „Ränder“ von Kirche (und das heißt auch: der digitalen Kirche) hinzuweisen und uns selbst klar zu machen, wie man diesen besser Gehör verschaffen kann.
Eule: Ihr arbeitet kollaborativ, auch unsere Fragen beantwortet ihr gemeinsam. Das ist für die universitäre Theologie eine echte Neuerung. Warum tut ihr euch das an?
Hanna: Ich finde es sowohl einfacher als auch schöner, zusammen zu denken. Natürlich ist es manchmal etwas schwerfälliger, kollaborativ zu arbeiten, aber insgesamt ist es total inspirierend und motivierend — und die Ergebnisse sind schlicht besser. Für mich ist das wirklich real erlebtes Wirken des Geistes: Man sitzt zusammen und nachher kommt mehr dabei raus, als wenn jeder für sich gedacht hätte. Das ist doch abgefahren.
Benedikt: Wo eine/r meint, eine befriedigende Antwort gefunden zu haben, kann das für andere vollkommen halbgar sein. Durch kollaboratives Vorgehen ist man geradezu gezwungen, dass man gerade Gesagtes/Geschriebenes viel klarer bekommt. Was bei Workshops und bei Bar-Camps vollkommene Normalität ist, kann man doch mit digitalen Mitteln total unkompliziert für das wissenschaftliche Schreiben adaptieren.
Wir drei haben vor Kurzem z.B. zu dritt einen Artikel geschrieben. Nicht mit „Version XY“ per Mail an die nächste Person und die schreibt dann weiter — sondern simultan und mit Videochat dazu. Das war für uns alle ein total spannender Prozess. Das ist dann nach mehrmals mehreren Stunden im Google-hangout schon auch irgendwann Nerven zerreibend.
Und was wir jeweils gelesen und vorbereitet und dann eingebracht haben, hat im Zusammenspiel für jede*n von uns ganz neue Erkenntnisse produziert, und insgesamt einen Artikel, der mit Sicherheit besser ist, als wir ihn hätten einzeln schreiben können. Wo so ein kollaboratives Arbeiten gelingt, lernt man einerseits voneinander, andererseits wird jede*r Einzelne auch darin bestärkt, etwas Wichtiges und Sinnvolles zu einem echten Erkenntnisprozess beitragen zu können, was es isoliert eben nicht gewesen wäre und man sich vielleicht auch gar nicht zugetraut hätte.
Thomas: Der „Geniekult“ schadet einfach der Forschung. Diese Schwierigkeit betrifft aber natürlich nicht nur die Theologie, sondern die Wissenschaft insgesamt, und vielleicht die Geisteswissenschaften besonders. Aufgrund bestimmter Anreize im System wird wahnsinnig viel publiziert, aber häufig im Modus von „ich auch“, anstatt dass kurze und zeitnahe Kommentare und Bezugnahmen, die die Diskurse schnell voranbringen, gleichwertig gewürdigt werden.
Wir würden uns eine Form von Theologie wünschen, die früher und intensiver auf Diskurs ausgelegt ist, als es bisher der Fall ist, wenn in hermetischen Artikeln mit Latenzzeiten von Monaten und Jahren aufeinander Bezug genommen wird. Kollaboration und „publish early-publish often“-Diskussionsoptionen sind dafür Beispiele.
Benedikt: Das Problem ist ja auch, dass keine*r den Geniekult so richtig aktiv aufgeben will. Alle reden davon, dass diese Zeit durch ist, aber das muss sich irgendwo niederschlagen. Wenn die „Gebildeten“ sich vornehmen, „sich einfach mal zurückzunehmen“, ist es ja damit nicht getan.
Zum einen wird diese Haltung in uns Geisteswissenschaftler*innen oft ab dem ersten Proseminar antrainiert und zum anderen muss man sinnvolle Alternativen zunächst mal erkunden und ausprobieren. Und da ist eine grundlegende Veränderung der Arbeitsform eine Möglichkeit, dass sich dann als Resultat davon auch die Denkweise, das Selbstverständnis von Theolog*innen und schließlich natürlich auch die Ergebnisse dieser Art des Theologisierens ändern.
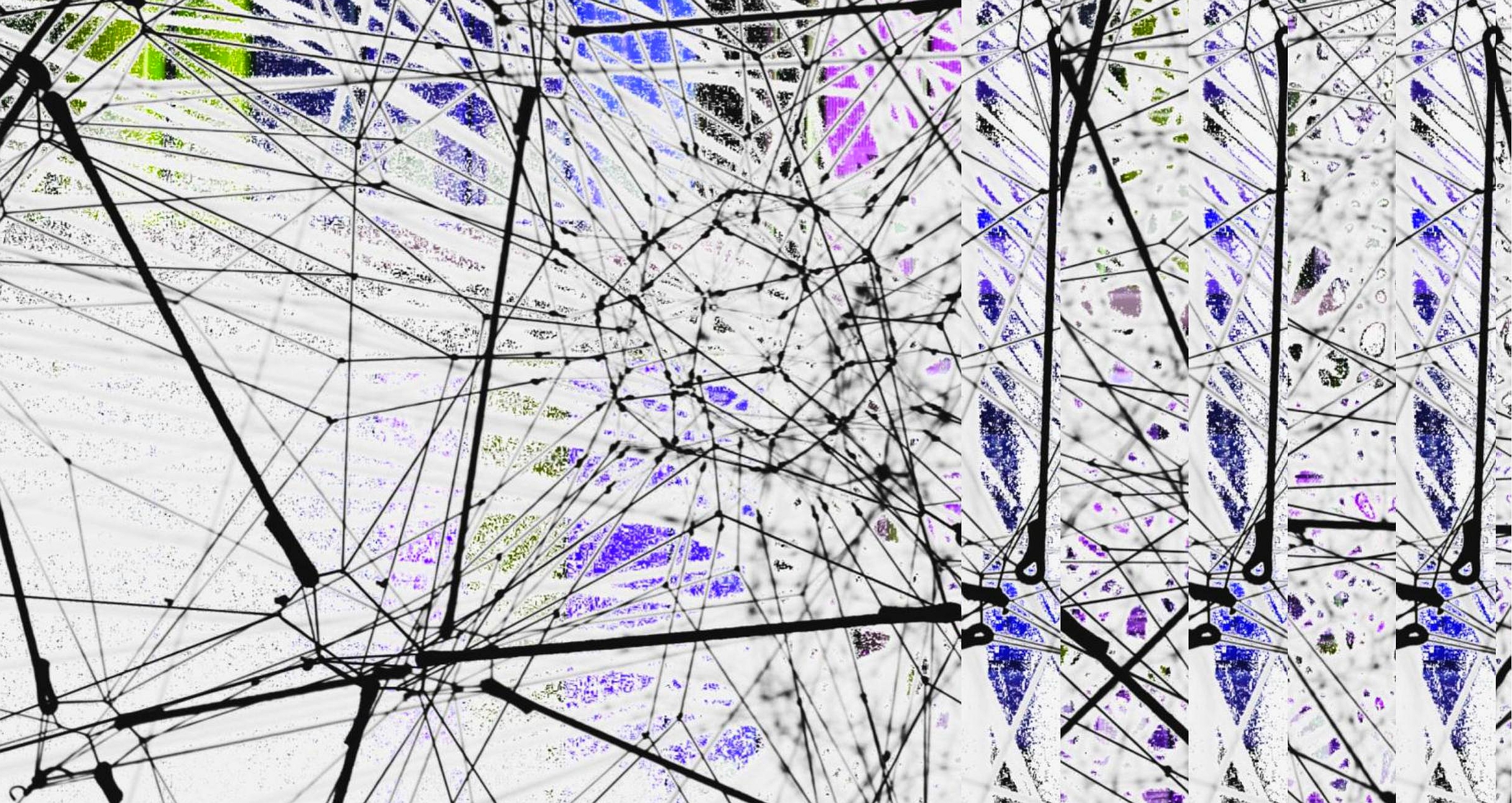
Montage: Philipp Greifenstein, mit Bild von Alina Grubnyak (Unsplash)
Eule: Wenn Theologie miteinander verhandelt wird, bedeutet das den Abschied davon, dass Theolog*innen nach Wahrheit suchen und Erkenntnisse formulieren?
Hanna: Nein, wieso? Im Gegenteil. Es bedeutet nur, dass sie erkennen, dass noch mehr Leute nach Wahrheit suchen und Erkenntnisse formulieren, und sich erlauben, davon in ihrer eigenen Wahrheitssuche und Erkenntnisformulierung zu profitieren.
Benedikt: Wir machen ja nicht Theologie als Kuschelkreis! Bei der Rede von Gott geht es doch um was! Und da macht es was aus, dass die Theologie sich durch mehr und andere Perspektiven irritieren und reinreden lässt als nur ein paar hochverdiente Klassiker und Koryphäen, die man in ihrer in Papier festgehaltenen Form zur Kenntnis nimmt – oder durch irgendwelche imaginierten Einwände, die man sich selbst beim Schreiben von Texten stellt, um vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken zu festigen. Das sind alles sehr erprobte und ausgefeilte Methoden, aber es ist einfach nicht verständlich, wie sie ein echtes Gespräch, Widerspruch aus der Sicht ganz andere Lebenskontexte und offen ausgesprochene Irritationen ersetzen können.
Thomas: Wenn es einen Abschied bedeutet, dann vielleicht der von der Vorstellung, dass jeder für sich im Kämmerlein auf exklusive Geistesblitze wartet und diese dann möglichst effizient ausgeschlachtet und vermarktet.
Benedikt: Naja, das Vermarkten ist ja an sich gar nicht schlecht, wenn es dazu führt, dass gute Erkenntnisse in die Diskussion gelangen und weitere Erkenntnisse produzieren. Nur: Wenn meine theologischen Erklärungen in einem hoch spezifischen Sprach-, Bildungs- und Lebensraum irgendwie Anklang finden, dann heißt das noch lange nicht, dass sie was taugen!
Citizen Theology soll ja gerade dadurch, dass man sich in anderen Öffentlichkeiten aufhält, auch ein bisschen diesen bildungsbürgerlichen Protestantismus dezentrieren. Aber dafür muss man wahrscheinlich die eingeschleifte Art der Wahrheitssuche, also ihren Habitus, ein bisschen aufrauen.
Hanna: Vielleicht kommt man bei dieser Wahrheitssuche auch gar nicht weiter, wenn man sich „Wahrheit“ als eine Sache vorstellt, die man besitzen und vielleicht sogar teilen kann, aber wo immer die Gefahr ist, dass ich dann selber nachher weniger habe. Vielleicht ist Wahrheit ja auch eher etwas, was sich einstellt, das einem aufgeht, aber wofür es immer eine*n Andere*n braucht – oder besser viele?
Eule: Ist Citizen Theology nicht eine Überforderung? Besteht die Schönheit der Theologie nicht gerade darin, dass sie geduldig nachdenkt, gerne auch von der Welt entrückt und das dann in dicken Wälzern studiert werden kann?
Hanna: Klar, das ist eine totale Überforderung. Theologie im Sinne des Nachdenkens über Gott und die Welt an sich ist eine totale Überforderung. Aber wir können’s nicht lassen usw. (Apg 4,20). Und könnte es diese überfordernde Sache nicht etwas erträglicher machen, wenn man sie eben nicht ganz alleine auf seinen Schultern tragen muss?
Citizen Theology hat nicht das Anliegen, Theologie künstlich komplizierter oder anstrengender zu gestalten, sondern eher, Potentiale, die schon da sind, zu erkennen und zu nutzen, damit es gemeinsam vielleicht nicht weniger anstrengend, aber weniger überfordernd ist.
Thomas: Die Schönheit einer der Welt entrückten Theologie, wie Du sie beschreibst, ist sicher ein gängiges Bild über den Forschungsstil der Theologie. Ob es empirisch zutrifft, wäre eine andere Frage. Aber davon abgesehen ist das Bild vergleichbar mit der Schönheit von Sprachwissenschaften, die sich auf den Minnesang konzentrieren, aber nicht sehen (wollen), dass auf der Straße und in den traditionellen sowie neuen Medien Sprache verwendet und geformt wird, die z.T. nicht unproblematisch ist. Eine Form von Theologie, die die Abgrenzungen zwischen „Laien“ und „Expert*innen“ runterfährt und eintauscht gegen einen breiteren Diskurs, könnte bei manchen sozialen und politischen Entwicklungen effektiv einschreiten.
Also z.B. wenn Jeff Sessions die Trennung und Internierung von Familien an der mexikanischen Grenze im Fernsehen mit Römer 13 begründet – und dafür von manchen sogenannten Expert*innen aus dem protestantisch-evangelikalen Lager beklatscht wird. Oder wenn AfD und Pegida vom „christlichen Abendland“ schwadronieren und dabei auch von manchen Christ*innen in Deutschland konfessionsübergreifend Zuspruch erhalten.
Uns interessiert dabei: Wie kann man es mittelfristig erreichen, dass bei solchen Gelegenheiten dann nicht nur Expert*innen, sondern eben eine ganze Menge anderer Leute einschreiten und sagen „da stimmt was nicht“? Dazu wären etablierte, eingeübte Praktiken theologischer Citizen-Diskurse notwendig, dass es also ein Stück weit normal ist, sich offen(er) über theologische Fragen auszutauschen. Die Debatten um Migration sind natürlich nur ein Beispiel, aktuell sind Fragen mit hohem theologischen Potenzial wie Bio- und Technikethik, Umweltschutz, Gender …
Benedikt: Und wenn dann ein paar schlaue und hochgelehrte Menschen aus den Universitäten kommen und hier Einspruch erheben, dann gibt’s Geschrei, dass wir als akademische Theolog*innen die Wirklichkeit nicht so sehen, wie sie an vielen Orten und im Leben vieler Menschen ist. Und vielleicht stimmt das sogar!
Aber wie gesagt: Das heißt nicht, dass man theologische Wahrheitssuche aufgibt, sondern dass man sie dezentriert und an bisher weniger im Zentrum stehenden Orten intensiviert. Und darum ist es wichtig, dass man die Vorstellungen von Gottes Wirken und das Reden von Gottes Willen in und für diese Welt ein Stück weit aus seiner akademisch-theologischen Korrektheit und Abstraktheit herausholt.
Thomas: Das „gerne auch von der Welt entrückt“ wird aus meiner Sicht zunehmend zur Hypothek nicht nur für die Theologie, sondern für Kirchen und Gemeinden selber. Die akademische Theologie hat, zumindest in Deutschland, kaum auf dem Schirm, wo, wie – und vor allem – dass an vielen Orten theologisch gearbeitet wird: Thesen werden in die Welt gesetzt, Erfahrungen geteilt und reflektiert: privat, wenn der Hund stirbt; öffentlich, wenn es neben vier Weihnachtsmärkten in der Stadt auch noch einen gibt, der sich „Wintermarkt“ nennt usw..
Theologie tut ihren Dienst sowohl in und für die Kirche als auch außerhalb und unabhängig von ihr nur dann, wenn sie neugierig auf die Welt sich selbst als Teil dieser Welt begreift und sich daher nicht ent-rücken, sondern zusammen mit der Welt ver-rücken lässt. Das ist die Schönheit von Citizen Theology, die möglicherweise mehr mit der Schönheit eines chemischen Experiments zu tun hat, das gerade im Labor abläuft, als mit der Schönheit einer Marmorstatue.
Eule: Letzte Frage: Hat Partizipation, also Mitmachen, nicht auch etwas mit dem Zutritt zu abgeschlossenen Sprachräumen zu tun? Habe ich Citizen Theology richtig verstanden, wenn ich darin auch die Herausforderung an Theolog*innen wie euch sehe, sich überhaupt verständlich zu machen?
Thomas: Das ist ein grundlegendes Problem: Einerseits ermöglicht wissenschaftliche Begrifflichkeit, etwas exakter und konkreter zu formulieren. Und wenn wir das gemeinschaftliche Nachdenken und Lernen auch im Verbund mit anderen Disziplinen suchen, multipliziert sich das Fachjargon erstmal. Und berechtigterweise lässt sich monieren, dass das nun die Zugänglichkeit für Nicht-Akademiker*innen eher noch verkompliziert als sie zu fördern.
Aber das ist eine Wette, die wir eingehen: Wir setzen nämlich darauf, dass die Einbindung von nicht-akademischen Perspektiven sowohl dazu führt, dass Theologie neue Ausdrucksformen – und damit vielleicht auch eine andere Sprache – annimmt als auch, dass sie dadurch gezwungen ist, gleichzeitig exaktere und konkretere Beschreibungen für die Dinge zu finden, die sie zu verstehen versucht. Wir hoffen, dass diese Wette aufgeht, denn sprachliche Barrierefreiheit oder zumindest weitgehende Niederschwelligkeit sind für den Erfolg von Citizen Theology natürlich wichtig.
Dass uns das selber noch nicht aus dem Stand heraus gelingt, hängt damit zusammen, dass wir eben noch am Anfang dieser Erkundung stehen – und deine Frage würden wir also weniger als Kritik oder Einspruch verstehen, und mehr als konstruktiven Beitrag dazu, gemeinsam an einer anderen Wissenschaftskultur zu arbeiten – genau darum geht es ja bei Citizen Theology.
