„Das Neue auf Dauer stellen“
Wie steht es um die Digitalisierung in den Kirchen? Ist die Corona-Krise tatsächlich eine Chance für #digitaleKirche? Philipp Greifenstein im Gespräch mit dem Digitalisierungs-Experten Hanno Terbuyken:
Eule: Manche sprechen davon, die Corona-Krise sei eine Zeit der großen Chancen für #digitaleKirche. Stimmt das?
Terbuyken: Es gibt eine Chance für digitale Gemeinde. Für die Gemeindepfarrer*innen besteht jetzt die Notwendigkeit zu schauen, auf welchen Kanälen Menschen erreicht werden können, wenn physisches Beisammensein nicht mehr funktioniert. Dabei spielen die digitalen Übertragungswege sowohl für die Weitergabe von Informationen als auch für Beziehungen eine ganz große Rolle.
Ich bin aber sehr skeptisch, wenn die übliche Dichotomie von „Chance und Risiko“ auf die Corona-Krise angesetzt wird. Es ist eine Notsituation, in der wir uns alle befinden, auch wenn manche Menschen das noch nicht erkannt haben. Es geht nicht zuerst darum, in ihr Chancen zu erkennen, sondern überhaupt erst einmal klar zu kommen.
Eule: Was hältst Du von den digitalen Gottesdiensten?
Terbuyken: Ich glaube, die Gottesdienste sind gar nicht das Problem. Diejenigen, denen der Gottesdienst fehlt, finden jetzt Ersatz, der mehr oder weniger adäquat ist. Beim Blick auf die Zugriffszahlen der Streaming-Gottesdienste dürften viele Gemeinden staunen: Wenn man sonst 25 Teilnehmer*innen hat und jetzt schauen 250 live oder hinterher zu, stelle ich mir schon die Frage: Ist das nicht wert, erhalten zu werden?
Es stimmt natürlich, dass Streaming-Gottesdienste häufig nur abgefilmt sind, ohne Rückkoppelung, ohne Interaktion. Das ist in Ordnung für den Moment. Ich glaube aber, dass der Vorteil der digitalen Form sich noch ein stückweit weiter manifestieren muss.
Eule: Ich beobachte in den letzten Wochen, dass die Streaming-Gottesdienste durchaus interaktiver werden – Fürbitten, Predigtgespräche, kreative Aktionen. Da merkt man schon, dass ein paar Wochen Erfahrung einen Unterschied machen.
Terbuyken: Der Gottesdienst ist der Teil kirchlicher Arbeit, auf den sich alle sofort gestürzt haben. Die andere Frage ist: Wie nutze ich digitale Mittel, um den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie Teil einer aufsuchenden Gemeinde sind – einer Gemeinde, die für sie da sein will und kann? Das ist schwieriger.
Wer da noch keine medial vermittelten Formen hat, also auch digitale, der muss sich jetzt überlegen, wie das geht. Ich glaube, dafür reicht es nicht, alle zwei Monate einen gedruckten Gemeindebrief in die Briefkästen zu stecken. Das ist zwar eine gute Erinnerung – Ach, die sind auch noch da! -, aber jetzt, da wir erleben, dass es vielen Menschen zuhause nicht notwendigerweise gut geht, weil die Routinen durchbrochen sind, weil sie Stress oder Angst haben, weil sie mit der Kinderbetreuung nicht klarkommen, muss da mehr geschehen.
Eule: Wie können digitale Werkzeuge dabei helfen?
Terbuyken: Es stellen sich viele Fragen: Wie können wir Menschen auch weiterhin einen Ausweichort bieten, einen Gesprächsort, ein Ventil, eine Ablenkung? Wie können wir sogar eine Hilfe sein? Das kann auch andere Formen haben als digitale. Wenn ich von einer Freundin höre, dass ihre schon älteren Eltern von ihrem Gemeindepfarrer überhaupt gar nichts mitkriegen, dann frage ich mich: Was hat der für ein Verständnis von Gemeindearbeit?
Zumindest zum Telefon zu greifen und die bekannten Senior*innen anzurufen, muss drin sein: Wie geht’s euch? Können wir euch Konfirmand*innen zur Einkaufshilfe vorbei schicken? Braucht ihr ein Gebet? Das kristallisiert sich natürlich um die Hauptamtlichen drumherum, weil sie diese Kommunikation steuern. Und diese Steuerung gelingt viel leichter mit digitalen Werkzeugen, die nicht Eins-zu-Eins funktionieren.
Wenn ich jedes Gemeindeglied einzeln anrufe, dauert das erheblich länger, als wenn ich allen oder Gruppen von Gemeindemitgliedern einen Newsletter schicken kann. Wenn ich meine Senioren anrufe, mit meinen Konfirmanden einen Zoom-Call mache und der Chor per E-Mail Übungen für zuhause bekommt, dann kann ich ein „Ja, wir sind eine Gemeinde!“-Gefühl erhalten. Ich wünsche mir, dass die Corona-Krise uns zumindest erkennen lässt, welche Möglichkeiten da noch sind und ausprobiert werden können.
Eule: Es wird immer deutlicher, dass diese Notsituation noch lange Zeit anhalten wird. Wahrscheinlich, bis es einen Impfstoff gibt.
Terbuyken: Das glaube ich auch. Bis dahin wird sich das ganze Zusammenleben schon so verändert und werden sich so viele neue Routinen ergeben haben, dass es ein Zurück zu dem Normal von Herbst 2019 auch nicht mehr geben wird. Das gilt auch für viele der neuen digitalen Formen, die werden jetzt auf Dauer gestellt werden müssen.
Eule: Was rätst Du Gemeinden in dieser Situation?
Terbuyken: Digitales Engagement ist natürlich zeitaufwendig, zielgruppenspezifisch und nicht immer einfach. Umso wichtiger ist es, sich nicht zu überfordern. Ich würde den Pfarrer*innen raten: Schaut, dass ihr das macht, was ihr gut könnt, worauf ihr Lust habt. Und überlegt euch, wo ihr euch für andere Gruppen in eurer Gemeinde Hilfe holen könnt, seien das Ehrenamtliche oder Kooperationen. Das machen ja viele Gemeinden schon, aber vor allem eben in der Form analoger Gesprächskreise. Die müssen wir jetzt auch digital abbilden – und dann ist es schwer vorstellbar, dass die nach der Corona-Krise auf die wöchentlichen digitalen Updates verzichten wollen.
Eule: Du hast den Newsletter als ein wichtiges Werkzeug gerade erwähnt.
Terbuyken: Der Newsletter ist für mich immer das erste Beispiel. Selbst wenn man den Gemeindebrief in Word zusammenstellt und dann ausdruckt, kann man den per Copy-Paste in einen Newsletter verwandeln. Das ist dann natürlich noch kein guter Newsletter, aber es funktioniert erstmal. Auch ein Newsletter ist eine spezifische Form, die man lernen kann und sollte. Das lohnt sich, weil sie eine niedrigschwellige Möglichkeit sind, den Menschen in Erinnerung zu rufen: Wir sind hier. Wir sind als Kirche und Gemeinde in der Mitte deiner Lebenswelt.
Eule: Was ist eigentlich der bessere Qualitätsmaßstab für digitale Angebote: Vom Medium und seinen Möglichkeiten her zu denken oder von den Bedürfnissen vor Ort?
Terbuyken: Es braucht immer ein Mindestmaß an Produktionsqualität, aber viele Menschen sind bereit, darüber weit hinweg zu sehen, wenn die Kommunikation direkt und personalisiert ist. Wir leben in einer Welt personalisierter Kommunikation, die uns direkt anspricht und nicht einfach so in die Welt gesendet wird. Alle Sozialen Netzwerke funktionieren nach diesem Prinzip. Das beginnt schon mit der namentlichen Ansprache in Newslettern.
Personalisierung wird als persönliche Verbindung erlebt, das spiegelt sich auch in der Vorliebe für den Gottesdienst-Stream der eigenen Gemeinde wider. Natürlich können die nicht mit den Fernsehgottesdiensten mithalten, was die Produktionsqualität angeht. Aber dafür kann ich als Zuschauer*in bei denen auch erstmal nichts mit der Person anfangen, die da zelebriert. Die persönliche Connection hat einen eigenen hohen Wert, und sie fehlt häufig. Gerade in einer Zeit, in der sich alles verändert, sind vertraute Gesichter und Stimmen wertvoll. Ich finde daher das „Überangebot“ von Streams überhaupt nicht problematisch.
Ich frage mich auch, wer außer uns, die wir mit dem Thema professionell befasst sind, denn vier oder fünf Streaming-Gottesdienste anschaut. Da müssen wir Medien- und Digitalisierungsprofis aufpassen, dass unser Blick nicht dadurch verzerrt wird, dass unsere Instagram-Feeds von allen kirchlichen Influencer*innen durchzogen sind, statt von nur zwei Kanälen unter hundert anderen Personen, denen man folgt.
Eule: Streaming-Kritik ist allerdings sehr angesagt, auch innerhalb der Kirchen.
Terbuyken: Das kann ich teilweise auch verstehen, natürlich muss das halbwegs anständig aussehen. Aber ganz ehrlich: Diese Qualitätsdiskussion brauchen wir doch für den analogen Gottesdienst genauso. Die Frage nach der Qualität kirchlichen Handelns müssen wir uns immer stellen.
Eule: Das ist für mich die Einsicht aus digitaler Kirche und die eigentliche Herausforderung, die sich durch digitale Formate der Kirche stellt: Alles kirchliches Handeln ist medial vermittelt. Mein Problem sind doch nicht der schlechte Ton oder die wackelige Kamera, sondern die Qualität liturgischer Bewegungen und Sprache. In den Predigerseminaren wird gefilmt, wie die Vikar*innen sich im Kirchenraum geben. Das machen viele Pastor*innen danach nie wieder.
Terbuyken: Es ist natürlich viel einfacher, einen aufgenommenen Gottesdienst hinterher zu bewerten. Das kann man tatsächlich jetzt nutzen. Ich glaube auch, dass da viel Material für die praktische Theologie entsteht. Mir ist wichtig festzuhalten, dass nicht jede Pfarrer*in alles können muss. Es gibt sowieso Pfarrer*innen, die besser predigen als andere. Eine sehr gute Predigt kann gerne mehrmals gehalten werden. Digital heißt das: Es müssen nicht alle das Gleiche machen, sondern wir können sehr wohl auf andere gute Angebote hinweisen. Am Ende zahlen alle digitalen Angebote auf ein gemeinsames Kirchenkonto ein.
Eule: Was meinst Du damit?
Terbuyken: Für die Nutzer*in ist es häufig nicht wichtig, aus welcher Landeskirche oder welchem Bistum ein Angebot kommt. Es gibt zwei Bezugsgrößen, die relevant sind: Die eigene Gemeinde und dann „Kirche“. Vielleicht noch „evangelisch“ und „katholisch“ dazwischen, aber auch das löst sich im Netz zunehmend auf.
Eule: Das hat allerdings auch zur Folge, dass einzelne Influencer*innen dann teilweise für offizielle Kirchenkommunikation gehalten werden. Ich erinnere an die Jana-Kontroverse im vergangenen Jahr, da warst Du mit dem GEP ja auch beteiligt.
Terbuyken: Wir haben aufgrund der Rückmeldungen deshalb im GEP das Sinnfluencer-Netzwerk „yeet“ an den Start gebracht. Das war meine letzte Aufgabe vor meinem Wechsel zu ChurchDesk, die ich dann sehr schnell an das Team um Lilith Becker und Denis Krick übergeben habe, die sich jetzt darum kümmern. Bei Influencer*innen ist die persönliche Kommunikation natürlich der entscheidende Faktor.
Deshalb ist Vielfalt hier besonders wichtig, damit unterschiedliche Anspruchsgruppen bedient und verschiedene Theologien und Glaubenszugänge abgebildet werden. Darum ist es auch richtig, dass „yeet“ als Netzwerk mit einem eigenen Label existiert und nicht nur im Hintergrund Influencer*innen unterstützt, die sich dann vielleicht selbst vernetzen. Nur wenn das Netzwerk sichtbar wird, dokumentiert es die Vielfalt der evangelischen Kirchen.
Eule: Sind die „Sinnfluencer*innen“ die Kirchtürme der digitalisierten Kirche?
Terbuyken: Sie sind die Küster*innen und Glöckner*innen. Das sind diejenigen, die am Seil ziehen – oder auf den Knopf drücken – und dann bimmelt es bei ihnen am lautesten.
Eule: Wo hat denn die christliche Publizistik ganz dringend dazu zu lernen?
Terbuyken: Wir müssen uns häufiger die Frage stellen, wie sich das, was wir tun, auf die gesamte Kirche auswirkt. Die christliche Publizistik, die von Kirchen mitgetragen, gesteuert und vor allem finanziert wird, darf diese Frage nicht ausblenden. Denn am Ende des Tages geht es schon darum, dass sich mehr Menschen taufen lassen. Das ist wesentliches Ziel der Gemeinschaft der Heiligen und es ist natürlich auch für den Erhalt der Institution wichtig. Es ist also legitim, nach dem Nutzen für die Institution zu fragen.
Ich sehe einen zweifachen Nutzen: Christliche Publizistik leistet einen wichtigen Beitrag zur Meinungsvielfalt in der Gesellschaft und sie sollte die Menschen daran erinnern, warum sie Mitglied der Kirche sein wollen. Mit Blick auf die Kirchenmitgliedschaftsentwicklung wird man diese Abwägung immer wieder vornehmen müssen.
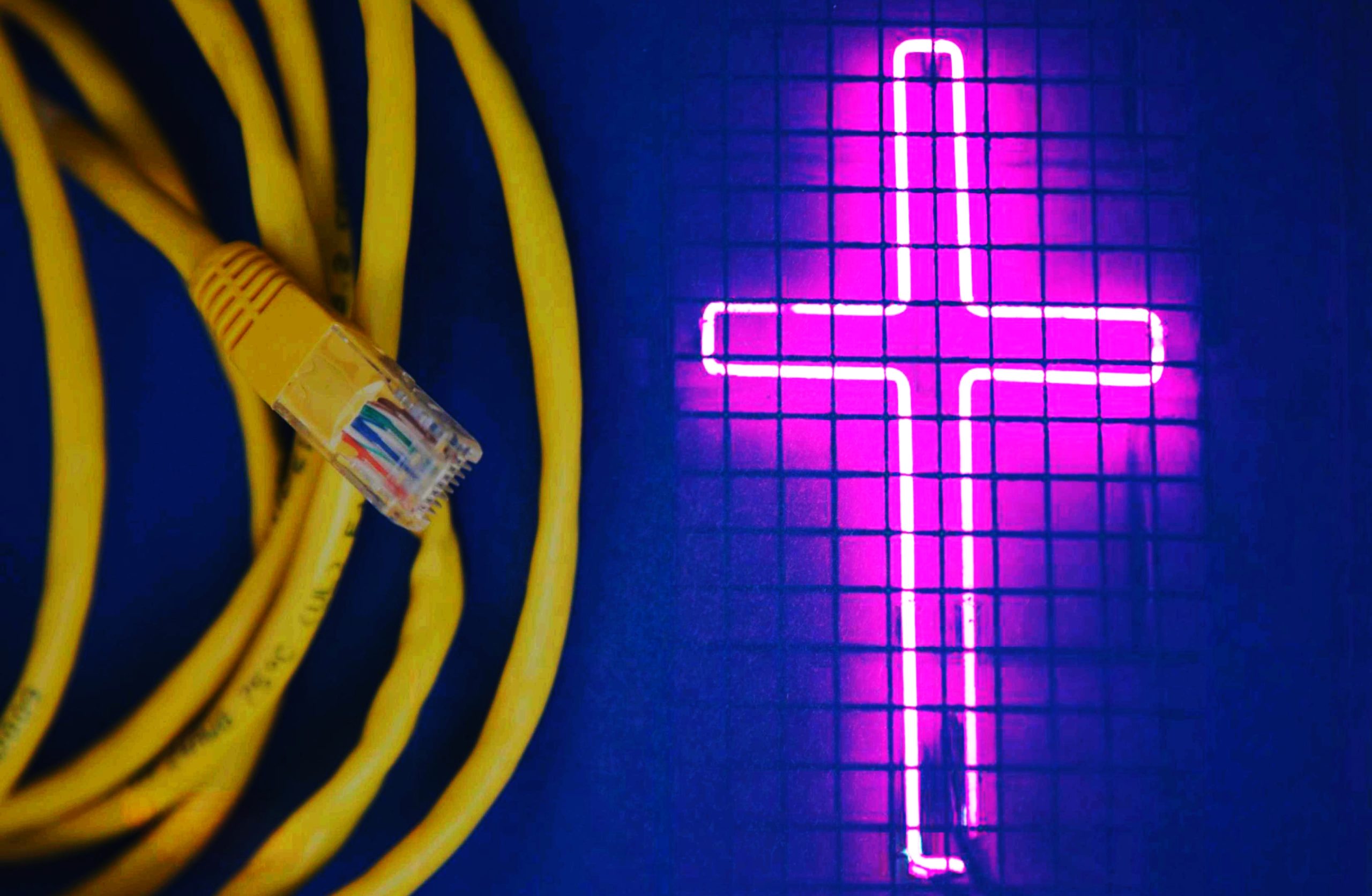
#digitaleKirche (Symbolbild), Fotos: Sean Mungur & Markus Spiske
Eule: Das Thema Digitalisierung wird in der Kirche immer wieder auf Social Media enggeführt, obwohl in vielen Büros immer noch Wägelchen mit Akten geschoben werden – von Themen wie #digitaleDiakonie ganz zu schweigen. Du hast bei evangelisch.de lange den Blog „Confessio Digitalis“ zu Digitalisierungsthemen geschrieben. Wie steht es denn um die Digitalisierung in den Kirchen?
Terbuyken: Wir kommen in der Kirche als missionarischer Veranstaltung immer von der Kommunikation her, weil das in der kirchlichen Genetik drinsteckt, aber Digitalisierung bedeutet so viel mehr! Das Grundprinzip, dass durch digitale Prozesse bisher bestehende Grenzen aufgelöst werden, dass viele Vermittlungsebenen wegfallen können – gilt in der Verwaltung genauso. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass man eine Kirche noch mit Karteikarten und Papierakten führt. Bei meinem neuen Arbeitgeber sind tatsächlich alle Arbeitswerkzeuge digital. Das macht übrigens auch das Homeoffice einfacher. Ich kann mich webbasiert in alle Anwendungen einloggen, die ich brauche, um meinen Job zu machen. Das erleichtert Arbeits- und Kommunikationsprozesse sowie Wissensmanagement. Das sind Sachen, die auch für die Kirche auf allen Ebenen wichtig sind.
Eule: Mir ist dabei immer das kritische Element wichtig: Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie ich eine Aufgabe digitalisieren kann, dann stelle ich damit auch die Frage mit, ob diese Aufgabe überhaupt notwendig ist.
Terbuyken: Es gibt ein ganz einfaches Anwendungsbeispiel: Ich bin schon viel umgezogen, also auch in verschiedenen Gemeinden angemeldet gewesen. Jedes Mal muss ich mit der Pfarrer*in vor Ort eine neue Beziehung aufbauen. Umso häufiger ich umziehe, desto schwieriger fällt mir das. Ich baue immer weniger intensive Beziehungen auf und muss dafür immer mehr Kraft aufwenden. Dass meine Kirchenhistorie, meine Tauf- und Konfirmationsdaten mitziehen, so dass ich von meiner Gemeinde vor Ort automatisch z.B. eine Tauferinnerung erhalte, habe ich noch nie erlebt. Darauf ist kirchliches Verwaltungshandeln gar nicht eingestellt.
Eule: Statt Gesundheitskarte, Kirchenkarte? Die Idee zu einer Mitgliedschaftskarte gibt es in der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck schon. Die Kirche als Big Data-Mine?
Terbuyken: Big Data ist ja nicht notwendig schlecht, nicht jede Nutzung von Daten ist automatisch negativ. Da brauchen wir auch einen klareren Blick auf Datenschutz und Datenverwendung. Wenn ich möchte, dass meine Daten auf diese Weise genutzt werden, dann möchte ich das auch gerne ermöglichen. Das ist auch nicht gleich „Big Data“, sondern individual Data. Big Data wäre es erst, wenn die Kirche dann aus der Menge der zur Verfügung stehenden Daten Schlussfolgerungen zöge.
Eule: Gott bewahre, da könnte man ja was draus lernen!
Terbuyken: Ich hätte überhaupt kein Problem damit, meiner Kirche das zu ermöglichen. Es gibt für Big Data auch ganz andere Anwendungsfelder, „predictive priesting“ zum Beispiel. Bei „predictive policing“ geht es um die Feststellung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Straftaten, um Polizeiarbeit besser zu koordinieren. Da gibt es zurecht auch Bedenken, weil Menschen aufgrund algorithmischer Berechnungen unter Verdacht geraten können. Man kann solche Daten aber natürlich auch weniger problematisch nutzen. Kirchen könnten feststellen, wo sich in den nächsten Jahren junge Familien ansiedeln werden, um dann dort viel Energie aufzuwenden.
Gegenüber Datennutzung gibt es in den Kirchen sowohl große Skepsis als auch große Fähigkeitslücken. Es gibt immer wieder Kirchen, in denen einzelne Projekte gestartet werden. Da müssten Kirchen besser darin werden, das auch weiterzuerzählen. Durch solche positiven Beispiele könnte gezeigt werden, dass Datennutzung und kirchlicher Datenschutz sehr wohl zusammengehen können. Das bedeutet zunächst aber einmal, dass die Verantwortlichen verstehen lernen, was Datenerhebung überhaupt bedeutet. Da kann man, glaube ich, noch einige weitere Fortschritte erzielen.
Eule: Das ist aber sehr kollegial formuliert.
Terbuyken: Ja, natürlich. Ich habe ja zehn Jahre einen internen Blick gehabt. Kirche liegt mir am Herzen! Ich bin damals mit Absicht in ein kirchliches Medienhaus gegangen und ich bin auch jetzt bei ChurchDesk in der Kirchennische geblieben. Hier will ich vor allem Gemeinden dabei helfen, die Digitalisierung zu meistern.
Meine Perspektive ist, danach zu fragen, wie Kirche mit all ihren Gliederungen und Unterteilungen an den Möglichkeiten einer digitalisierten Gesellschaft teilhaben kann. Es kann nicht darum gehen, eine Vergangenheitsinstitution zu erhalten in einer Welt, in der viele Menschen diese nicht mehr wollen. Deshalb führen uns die Fragen der Digitalisierung immer wieder zu den wichtigen Fragen für die Kirche: Was machen wir eigentlich, für wen, und wie?
Das Interview führte Philipp Greifenstein.
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.
