Die gestaltbare Wirklichkeit entdecken
Drei Sachbücher laden zur Gestaltung der Realität in Kirche und Gesellschaft ein. Jan Loffeld, Julia Schönbeck und Stefan Weigand stellen Fragen, denen Leser:innen in diesem Sommer nachdenken können.
Sommerzeit ist Ferienzeit ist Lesezeit. Leon Hanser, Philipp Greifenstein und Mario Keipert stellen an dieser Stelle drei Sachbücher vor, die Menschen in Kirche und Theologie beschäftigen (sollten):
Über die Zukunft von Glaube und Kirchen schreibt Jan Loffeld in seinem Buch „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt“, das insbesondere in der katholischen Kirche bereits viel gelesen wurde. Julia Schönbeck entwirft in „Nicht ohne uns“ ein Bild von einer inklusiven Kirche, in der behinderte Menschen nicht mehr außen vor bleiben. Und Stefan Weigand schreibt in seinem bereits im Jahr 2020 erschienenen Buch „Wunder warten überall“ über die Wiederentdeckung der einfachen Dinge.
“So wie du deine Tage verbringst, so verbringst du dein Leben“, zitiert er Annie Dillard. Wie könnte man den Sommer besser verbringen als lesend?

Gottlos glücklich – What’s the news?
Von Leon Hanser
Es gibt da dieses Meme-Template, das ein kleines Mädchen in einem Autositz zeigt. Es hat blondes Haar, Pausbacken und skeptisch-zusammengezogene Augenbrauen, deren Ernsthaftigkeit nicht so recht zu den herrlich süßen Milchzähnen passen. In Chatverläufen und auf Social-Media-Plattformen wurde „Side Eyeing Chloe“ lange Zeit ausgewählt, um dem Gegenüber zu sagen: „Ich verstehe nicht so ganz, was dein Punkt ist.“
Bei Jan Loffelds „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt“ habe ich oft an Chloe gedacht. Der deutschstämmige Professor für Praktische Theologie an der Universität Tilburg in Utrecht schreibt auf 180 Seiten flüssig lesbar runter, dass die kirchliche Relevanzkrise – die in den Niederlanden bereits schärfer zutage tritt als hierzulande – nicht am Reformstau in den Amtskirchen liegt, sondern an der mangelnden Nachfrage nach dem Evangelium.
Die Botschaft Jesu ist eine Antwort auf eine Frage, die sich in säkularen Gesellschaften fast niemand mehr stellt. Menschen kommen auch ohne Transzendenzbezug ganz okay durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Sie sind gottlos glücklich. Der mind blow, den Loffeld da gefunden zu haben meint, will sich bei mir nicht recht einstellen. War das nicht, äh, schon immer so?
In den Psalmen stellen David, Asaf und Co. immer wieder genervt fest, dass „die Gottlosen“ im Grunde ganz zufrieden sind. Jeremia regt sich darüber auf, dass sein Leben als Prophet Gottes ihm an vielen Stellen nichts als Ärger gebracht hat. Und was die Apostel auf ihren Reisen erlebt haben, erinnert weniger an Jochen Schweizer und mehr an „Final Destination“. Keine Frage: Das Vertrauen auf den Gott der Bibel ist kein Glücksbringer. Im Gegenteil kann der Glaube daran, dass Liebe, Gerechtigkeit und Vergebung göttlicher Wille für die Welt sind, ziemlich unglücklich machen. „Friede mit Gott bedeutet Unfriede mit der Welt“, hat Eberhard Jüngel mal geschrieben.
Die Stärke von Loffelds Buch ist nicht die empirische Analyse einer letztlich alten theologischen Einsicht. Sie liegt vielmehr in der warmherzigen Beschreibung eines kniffligen Dilemmas aus der Feder eines Praktikers: Die Kirchen kommen um grundlegende Reformen nicht herum. Schwindende Ressourcen und beschämende Skandale lassen keinen anderen Schluss zu. Doch selbst erfolgreiche strukturelle Veränderungen werden nichts an der mangelnden Nachfrage nach dem Evangelium ändern. Die Kirchen können sich nicht in schwarze Zahlen hineintransformieren. Und müssen dennoch schmerzhafte Einschnitte beschließen.
Das ist eine bittere Kröte. Hat man die aber mit einem guten Schluck Abendmahlswein runtergeschluckt, stellt sich eine gewisse Beinfreiheit ein. Ted Lasso liegt richtig, als es dort einmal gut biblisch heißt: „The truth will set you free – but first, it will piss you off.“ Die Kirchen können ihre Schrumpfung nicht aufhalten. Sie können sie aber in aller Freiheit und Kreativität gestalten. Wenn sich dieser Optimismus mal durchsetzen würde; das wäre eine Neuigkeit!
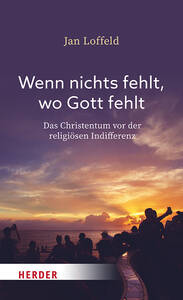 Jan Loffeld
Jan Loffeld
Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt
Das Christentum vor der religiösen Indifferenz
Verlag Herder
192 Seiten
22 € (gebunden), 16,99 € (E-Book)
Inklusive Kirche werden
Von Philipp Greifenstein
„Ich hoffe auf eine Kirche, in der ich mitdenken kann, statt mitgedacht zu werden.“ Mit diesem eindringlichen Satz und einem „Amen – So sei es!“ schließt Julia Schönbeck ihr Buch „Nicht ohne uns“. Doch noch ist gelingende Inklusion behinderter Menschen in den Kirchen keine Realität.
Mit ihrem Buch über eine inklusive Kirche legt Julia Schönbeck ein persönliches Zeugnis ab. Sie sensibilisiert für die Realität der Ausgrenzung behinderter Menschen in Kirche und Gesellschaft – und fordert dazu auf, Barrieren nicht nur zu benennen, sondern aktiv abzubauen. Das Buch versteht man am besten als ein Gesprächsangebot aus Betroffenenperspektive, also von einer derjenigen, die eben so häufig „nicht da sind“, weil sie die Mehrheitsgesellschaft an „Sonderorten“ für „besser aufgehoben“ hält.
„Nicht ohne uns“ hilft dabei, klar zu sehen, dass durch Ableismus ebenso wie durch Rassismus, Klassismus und andere Diskriminierungen unsere Kirche selbst zu einem Sonderort geworden ist – nur eben für jene, die dem Ideal vom „normalen“, gesunden, fähigen, intellektuell anspruchsvollen, schönen und unverletzten, nicht zuletzt Weißen Menschen entsprechen.
„Nicht ohne uns“ von Julia Schönbeck ist kein theologisches Fachbuch, sondern ein niedrigschwelliger Einstieg in den Inklusionsdiskurs. Schönbeck erläutert zentrale Begriffe verständlich, das Buch bietet Erklärboxen für Fachsprache, einige praktische Hinweise zur Gestaltung inklusiver (Kirchen-)Räume gibt es auch. Themen wie die biblischen Heilungsgeschichten oder diskriminierende liturgische Sprache werden angerissen.
„Nicht ohne uns“ kann zur Weiterbeschäftigung mit der (theologischen) Fachpublizistik zu Inklusion und Ableismuskritik motivieren, spiegelt deren Vielfalt aber nur fragmentarisch wider. Das Buch ist ein guter Einstieg ins Themenfeld, auch und besonders für junge Leser:innen. Das Buch lebt von der persönlichen Stimme der Autorin. Es will nicht abschließend informieren, sondern zum Weiterdenken, Weiterfragen und Weiterhandeln anregen.
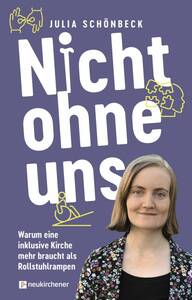 Julia Schönbeck
Julia Schönbeck
Nicht ohne uns
Warum eine inklusive Kirche mehr braucht als Rollstuhlrampen
Mit Beiträgen von Heike Heubach und Lena Müller
Neukirchener Verlagsgesellschaft
171 Seiten
18 € (Softcover)
Wunder warten überall
Von Mario Keipert
Auf dem Schreibtisch von Stefan Weigand stehen zwei Emaille-Kannen mit Stiften, Scheren, Brieföffner. Im Büro gibt es gelbe Postkisten. „Eigentum der Deutschen Post AG“ steht auf ihnen geschrieben. In seinem Haus finden sich ein Schallplattenspieler, Teeschalen und irgendwo mindestens (!) eine Schreibmaschine. Zeitungen und Notizbücher: sicher. Auch ein Fahrrad darf nicht fehlen. Und der Espresso für die Pause.
Meine Pausen verbringe ich seit einiger Zeit regelmäßig mit Stefan Weigands Buch über „Die Wiederentdeckung der einfachen Dinge“. Es heißt: „Wunder warten überall“. Es erwartet mich mit einer fast bescheiden zu nennenden Schlichtheit auf dem Wohnzimmertisch: Ein kompaktes, schmales Bändchen, das geradezu alltäglich daherkommt – womit wir beim Thema wären. Weigand schreibt im Grunde über seinen Alltag, über alltägliche Begleiter und scheinbar Nebensächliches, mit dem wir doch einen großen Teil unseres Lebens verbringen.
“Während wir uns an den abstrakten Sinnfragen des Lebens abarbeiten, übersehen wir die überschaubare und gestaltbare Wirklichkeit“, schreibt Frank Berzbach in seinem Buch über Formbewusstsein. Weigand, der als Mediendesigner in Schwäbisch Hall lebt und die Gestaltung z.B. des Jesuiten-Magazins verantwortet, schreibt weniger grundsätzlich und ganz konkret. Ob über Bleistifte, Schreibmaschinen, Fahrräder, Schallplatten oder Quitten: Er setzt Objekte und Themen nicht nur in wunderschönen Still-Leben in Szene, er widmet all den einfachen Begleitern seines Alltags auch Essays voller Ver- und Bewunderung, so dass all die kleinen Dinge ganz groß werden. Jeder seiner Texte ist eine Insel der Achtsamkeit und der Ruhe im Strom der Zeit. Nebensächliches wird zur Hauptsache.
“So wie du deine Tage verbringst, so verbringst du dein Leben“, zitiert Weigand Annie Dillard. Aus dem Konkreten, Alltäglichen, vermeintlich Banalen – aus dem, was wir so gern für selbstverständlich nehmen und übersehen – besteht nun einmal das Leben. Wie in einem Katalog blättert man sich interessiert von Fundstück zu Fundstück und entdeckt manche neue Perspektive auf Dinge, die auch im eigenen Alltag eine Rolle spielen. Dieses Buch ist eine Einladung zum Innehalten, genau Hinschauen, eine bewusste Vorbeugung.
Gleich zu Beginn schildert Weigand den Besuch in der Werkstatt eines Töpfers, wo aus einem Erdklumpen eine Teeschale entsteht. „Das braucht jetzt seine Zeit. Es geht nicht anders – erst, wenn eine Mitte da ist, kann ich weitermachen“, erklärt der Töpfer. „Ein Werk ohne klare Mitte ist nicht unmöglich.“ Diese Mitte ist die Ruhe, das Verweilen, zu dem jede von Weigands Betrachtungen einlädt. Eine Entschleunigung, die Kontakt herstellt zu der Welt um und in uns.
In Wim Wenders’ Film „Perfect Days“ blickt der Toilettenreiniger Hirayama jeden Morgen in den Himmel – um auch im Tagesverlauf immer wieder kurz den Kontakt zu dieser ihn umgebenden, umfassenden Wirklichkeit herzustellen. Diese Geste ist für mich der tiefste Ausdruck für Achtsamkeit: ein Sein in der Gegenwart. Kurzes Innehalten, Aufmerken, Staunen: das verändert die Haltung zur Welt. “Manchmal genügen ein paar Lichtteilchen, die die gut 149 Millionen Kilometer von der Sonne zur Erde auf sich genommen, um hier den Dielenboden zu verzaubern“, schreibt Weigand. Mir hilft da manchmal auch einfach sein Buch. Wie heißt es bei Mary Oliver?
Anweisungen für das Leben:
Gib acht.
Sei erstaunt.
Erzähl davon.
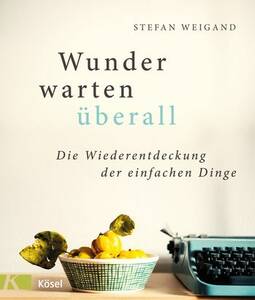 Stefan Weigand
Stefan Weigand
Wunder warten überall
Die Wiederentdeckung der einfachen Dinge
Kösel Verlag
144 Seiten
22 € (Hardcover)
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.
