Rebellen am Bau
Florus und Laurus missionieren für das junge Christentum, obwohl sie als Steinmetze an paganen Heiligtümern arbeiten. Die Kirchengeschichte des Balkans hält noch viele Neuentdeckungen bereit.
Sehr zu Leidwesen meiner Begleitungen kann ich, wenn ich auf Reisen bin, nie so ganz aus meiner Haut: Die Kirchengeschichtlerin in mir sucht immer nach neuen Episoden aus der Geschichte, von denen ich noch nie gehört habe, oder nach sichtbaren Überresten der großen Geschichten, die ich in- und auswendig kenne.
Und Kirchengeschichte auf Reisen verbindet: Als ich aus meinem letzten Urlaub ein Foto von Ohrid in Nordmazedonien postete, bekam ich direkt eine Nachricht von meinem Doktorvater, der in seiner Dissertation unter anderem einen mittelalterlichen Theologen aus diesem Ort behandelt hatte.
Der Balkan verspricht dabei auf den ersten Blick, besonders spannend zu sein. Schließlich ist es diese Region, die in der geographischen Mitte zwischen Rom und Konstantinopel (oder Istanbul) liegt und damit genau zwischen den beiden wichtigsten Städten (nicht nur) der antiken Christenheit: Rom für den Westen des Römischen Reiches und die Kaiserstadt Konstantinopel für den Osten. Auf der Luftlinie liegt die Mitte zwischen beiden Städten in Nordmazedonien, leicht nördlich des Mavrovosees.
Häufig ist das Erkunden der alten Kirchengeschichte in dieser Region trotzdem ein Fischen im Trüben. Oftmals wissen wir im Grunde gar nichts, obwohl es Belege dafür gibt, dass es in diesen Regionen schon sehr früh Christ*innen gab. Erst im Mittelalter bewegt man sich auf zusehends sichererem Boden. Doch schon Paulus berichtet Mitte des 1. Jahrhunderts, er habe das Evangelium in Illyrien (dem heutigen Westbalkan) verkündigt (Röm 15, 19) und auch im ehemaligen Dardanien in der Mitte der Balkanhalbinsel gibt es frühe archäologische Zeugnisse für Christentum vor Ort.
An der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert nach Christus entsteht südlich von Pristina im Kosovo die römische Stadt Ulpiana, die ihren Namen dem Kaiser verdankt, der sie gegründet hat: Marcus Ulpius Trajan. Diese Siedlung liegt von Rom etwa 720 km Luftlinie entfernt, vom heutigen Istanbul 670 km und damit ebenfalls auf der Grenze zwischen den beiden Einflussbereichen.
Die Hauptakteur*innen sind Zugewanderte
Christliche Missionsbestrebungen gehen in dieser Gegend zumeist vom Osten des Römischen Reiches aus. Wir wissen wenig Sicheres über das frühe Christentum in Ulpiana − bis auf die Tatsache, dass es hier in der Antike Christentum gab. Die wohlhabende Stadt hatte einen eigenen Bischof, zudem in der Spätantike mindestens eine große christliche Basilika und ein klassisches Baptisterium für die Taufe von zum Christentum konvertierten Menschen.
Zu den wenigen bekannten Christ*innen, die mit Ulpiana namentlich in Verbindung gebracht werden, zählen die Zwillingsbrüder St. Florus und St. Laurus, die als Missionare in der Stadt waren. Die beiden sind vermutlich schon bald nach der Gründung der jungen Stadt im Laufe des 2. Jahrhunderts in Ulpiana angekommen.

Reste des Baptisteriums in Ulpiana (Foto: Johanna Jürgens)
Florus und Laurus sind gelernte Steinmetze aus dem Gebiet des späteren Konstantinopels, die womöglich aus ihrer Heimat fliehen müssen, als ihre ebenfalls bereits christlichen Lehrmeister getötet werden. Typisch für die Anfangszeit der christlichen Überlieferung vom westlichen Balkan ist, dass die Hauptakteur*innen von außerhalb kommen und nicht aus dem Land selbst stammen.
Der Beruf des Steinmetzes ist in der Antike keiner, der sich leicht mit dem Christentum vereinbaren lässt: Eines der Hauptbetätigungsfelder ist die Herstellung von paganen Götterstatuen und das Bauen von Tempeln. Schon in der Bibel wird von Konflikten zwischen christlichen Missionaren, die sich gegen den paganen Kult stellen, und Kunsthandwerkern, die vom Kultbetrieb finanziell abhängig sind, berichtet (Apostelgeschichte 19,23−40).
Auch Florus und Laurus werden bedingt durch ihre Anstellung mit dem Götterkult konfrontiert: Die beiden Steinmetze werden für den Bau eines paganen Tempels angestellt. Doch obwohl die Zwillinge die aufgetragene Aufgabe korrekt ausführen, zeigt sich hier das Christsein der beiden in kleinen rebellischen Akten. So weigern sich die Brüder, den Lohn für ihre Arbeit selbst zu behalten und so vom paganen Kult zu profitieren. Stattdessen spenden sie das Geld in Gänze an die Bedürftigen.
Außerdem gelingt es ihnen, einen paganen Priester zum Christentum zu bekehren, indem sie seinen Sohn heilen, der sich durch Unachtsamkeit auf der Baustelle verletzt hatte. Der Junge war durch einen Splitter im Auge einseitig erblindet, konnte aber durch das Gebet der Heiligen wieder sehen. Vater und Sohn sind von dieser Zeichenhandlung beide so beeindruckt, dass sie sofort Christen werden.
Im Endeffekt bekehren die Brüder während der Tempelbauzeit so eifrig unter den Bewohner*innen der Stadt, dass am Ende kaum noch Bedarf für ein nicht-christliches Gotteshaus zu bestehen scheint. Was mit dem Tempelgebäude geschieht, wird, je jünger die Legenden sind, immer drastischer geschildert. Entweder haben die Christ*innen des Ortes das Gebäude schlicht in eine Kirche umgewidmet, ein Kreuz aufgestellt und eine Nacht vor Ort im Gebet verbracht. Oder aber Florus und Laurus haben einen zerstörungswütigen Mob dazu angeleitet, alle frischgebauten Götterbilder zu zertrümmern, das Gebäude vollkommen zu entweihen und auf den Ruinen das Kreuz aufzustellen.
Von Lokalmärtyrern zu Schutzheiligen
Jedenfalls steht am Ende kein neuer Tempel in der Stadt, sondern eine frühe christliche Kirche, die den Behörden ein Dorn im Auge ist. Die Reaktion der römischen Obrigkeiten ist drakonisch: Den Legenden zufolge sollen hunderte frisch bekehrte Christ*innen durch Feuer getötet worden sein, unter ihnen der ehemalige pagane Priester und sein Sohn. Auch Florus und Laurus als Anführer finden den Tod. Sie werden auf Anordnung der Provinzregierung in eine leere Zisterne geworfen und darin lebendig begraben.
Wie so oft endet die Geschichte der Heiligen jedoch nicht mit ihrem Tod. Ihre Gebeine werden einige Jahrzehnte später auf wundersame Weise völlig unverwest in der Zisterne wiedergefunden und nach Konstantinopel gebracht, als dort mit Konstantin dem Großen ein christenfreundlicher Kaiser auf dem Thron sitzt.

Reste der Basilika von Ulpiana (Foto: Johanna Jürgens)
Konstantins Mutter Helena − heutzutage passenderweise unter anderem die Heilige des Wiederfindens verlorener Dinge − begründet zu dieser Zeit als erste große Sammlerin die Jagd nach Reliquien. Viele sterbliche Überreste und Gegenstände werden von ihren angestammten Orten in wichtige Kirchen und Paläste der Welt überführt. Aus dem Hochmittelalter gibt es noch den Bericht eines Pilgers, der die Überreste der Zwillinge Florus und Laurus in Konstantinopel gesehen haben will. Später verliert sich ihre Spur.
Die beiden Heiligen sind heute vor allem noch in der Ukraine und Russland bekannt. Als Schutzheilige sind sie für Pferde zuständig. Diese Aufgabe, die sich aus der Vita der Brüder nicht so recht erklären lässt, ist ihnen posthum zugekommen: Am Tag, an dem ihre Gebeine gefunden wurden − angeblich am 18. August, der heute der Gedenktag von Florus und Laurus ist − ging eine schwere Pferdeseuche schlagartig zu Ende, was man den Reliquien zuschrieb. Es soll Unglück bringen, am Gedenktag der beiden mit Pferden zu pflügen.
Ob sich in Ulpiana trotz der tragischen Ereignisse das Christentum im zweiten Jahrhundert halten konnte, wissen wir nicht. Spätestens ab dem 4. Jahrhundert legen die archäologischen Grabungen nahe, dass es eine starke christliche Präsenz und mehrere christliche Bauten gegeben hat. Die Bischöfe von Ulpiana sollen an den großen Konzilien und Synoden ihrer Zeit teilgenommen haben. Die Stadt wird allerdings schon 518 durch ein heftiges Erdbeben zerstört.
Kaiser Justinian baut die Siedlung später wieder auf und benennt sie in Justiniana Secunda um, schließlich will auch dieser Kaiser sich selbst ein Denkmal setzen. Aus der Zeit Justinians stammt wohl auch die große Basilika, deren Überreste heute noch bei Graçanica im Kosovo zu bestaunen sind − möglicherweise war diese Kirche einst den beiden Lokalmärtyrern Florus und Laurus gewidmet. Auch wenn es einen zeitweiligen Abbruch christlichen Lebens vor Ort gegeben hat, hat sich also das Andenken an die ersten Missionare und Märtyrer von Ulpiana bewahrt.
Mit diesem Artikel von Johanna Jürgens endet die 2. Staffel von „mind_the_gap“. Alle Ausgaben finden sich hier in der Eule. Wir danken Johanna Jürgens sehr für ihre spannenden Einblicke in die Geschichte des antiken Christentums! Im Herbst 2025 setzen wir die Kolumne „mind_the_gap“ über vergessene Kirchengeschichte(n) mit einer weiteren Staffel fort.
mind_the_gap – Vergessene Kapitel der Kirchengeschichte
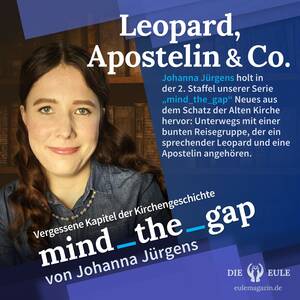 Aus dem Schatz der Alten Kirche kramt Johanna Jürgens Neues hervor. Im Frühjahr / Sommer 2024 ging es mit Flora Hochschild bei „mind_the_gap“ bereits um vergessene Kirchengeschichte(n) aus der Frühen Neuzeit. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!
Aus dem Schatz der Alten Kirche kramt Johanna Jürgens Neues hervor. Im Frühjahr / Sommer 2024 ging es mit Flora Hochschild bei „mind_the_gap“ bereits um vergessene Kirchengeschichte(n) aus der Frühen Neuzeit. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!
Alle „mind_the_gap“-Kolumnen hier in der Eule.
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.
