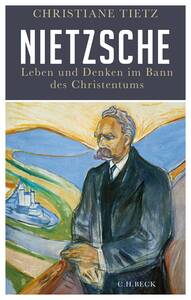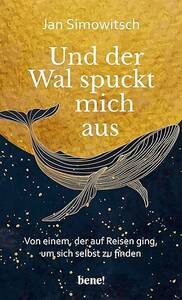Lesen und Denken im Lichtkegel des Glaubens
Christiane Tietz und Jan Simowitsch schreiben über die Deutung des Lebens im Lichte oder Bann des Christentums. Ob bei Friedrich Nietzsche oder im Walfischbauch: Der Glaube bleibt im Spiel.
Die Blätter und Temperaturen fallen, bereits in den Nachmittagsstunden senkt sich die Dunkelheit über Straßen und Plätze. Die bürgerliche Moral gebietet es, nun da es Herbst geworden ist, viel Tee zu kochen, die Kürben zu bewundern, sich in Erker oder Sessel zu bequemen – und zu lesen. Zwei Schmöker bieten sich für die herbstlichen Lese- und Mußestunden an:
Benedikt Skorzenski stellt ein neues Buch über Friedrich Nietzsche von Christiane Tietz vor: In „Nietzsche: Leben und Denken im Bann des Christentums“ untersucht sie, welchen Einfluss der christliche Glaube auf Leben und Werk des zornigen Religionskritikers (bis ganz zum Schluss) hatte. Mario Keipert hat die persönlichen Erkundungen von Jan Simowitsch, die unter dem schönen Titel „Und der Wal spuckt mich aus“ erschienen sind, mit Gewinn gelesen. Ein perfektes Buch für die Lebensmitte und den Herbst des Jahres?
(K)eine Heimholung
Von Benedikt Skorzenski
„Kritik ist die extremste Form der Kooperation“ – so habe ich es auf einer Fortbildung gehört, kurz nachdem ich das neue Nietzsche-Buch von Christiane Tietz gelesen hatte. Dieses Bonmot trifft ganz gut die Art und Weise, mit der sich die Autorin dem Gegenstand ihres Buches nähert: Mit dem, was durchaus nicht konstruktiv gemeint ist, soll konstruktiv weitergearbeitet werden.
Christiane Tietz ist seit Januar 2025 Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), zuvor studierte und forschte sie an den Universitäten in Frankfurt (Main) und Tübingen und war in Mainz (2008-2013) und Zürich (2013-2024) Professorin für Systematische Theologie. Mit „Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch“ legte sie im Jahr 2019 eine vielbeachtete Biografie von „Gottes fröhlichem Partisanen“ vor.

Christiane Tietz (Foto: Peter Bongard / EKHN)
Mit ihrem Nietzsche-Buch verfolge sie keineswegs das Ziel, den als Christentumskritiker berühmten „Nietzsche als religiösen Menschen zu vereinnahmen oder gar zu entlarven“ (S. 9), stellt Tietz zu Beginn von „Nietzsche: Leben und Denken im Bann des Christentums“ klar. Vielmehr gehe es darum, „Nietzsche zu Wort kommen zu lassen […], seinen Lebensweg mit einem empathischen Blick zu betrachten und ihm erst einmal zuzuhören“ (S. 181). Das wird mit dem Vorgehen eingelöst, das bereits aus Tietzens sehr lesenswerten Darstellungen der Lebens- und Denkwege von Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer bekannt ist:
Im Haupttext wird viel und ausführlich aus den Quellen zitiert, die Fundstellen werden im Endnoten-Apparat sauber nach aktuellen wissenschaftlichen Ausgaben nachgewiesen. So gewinnt beispielsweise Nietzsches christliche Kindheit und Jugend deutlich an Profil, wenn auch um den Preis, dass die Zitate aus den süßlich-frommen Jugendgedichten beim Lesen eine gewisse Länge entfalten.
Tietz erklärt Nietzsche nicht zum heimlichen Christen, aber sie entfaltet in den zwölf Kapiteln ihres Buches, „dass Nietzsche das Christentum als Thema nicht loswurde“ (S. 9) – bis dahin, „dass ihn christliche Konzepte bis in seine letzten wachen Momente hinein beschäftigten“ (S. 181). Sich mit diesem Menschen zu befassen, der sich sein Leben lang intensiv mit dem Christentum auseinandergesetzt hat, bedeutet für Tietz eine Pflicht und eine Chance: Die Pflicht, sich seiner Kritik zu stellen, die Chance, auf diese Weise neu vom Glauben zu reden (S. 181).
Nietzsche wird nicht in den Kreis der Glaubenden hineingeholt, wohl aber in den Diskurs der Theologie. Er mag „kein bequemer Gesprächspartner für die Theologie“ (S. 181) sein, aber er wird doch zum Partner im denkenden Ringen um den Glauben. Im Epilog wird das leider nur auf wenigen Seiten angerissen – ich hätte gern mehr darüber gelesen, wie Tietz mit und gegen Nietzsche weiterdenkt.
Nietzsches Denken vor dem Hintergrund seiner Biografie
Vor die kritische Auseinandersetzung gehört allerdings die differenzierte Wahrnehmung und dieser ist der Hauptteil des Buches gewidmet. Zunächst stellt Tietz biographisch dar, von welcher Frömmigkeit Nietzsche familiär geprägt wurde, wie er darin gelebt, aber auch Krisen erlebt hat (Kapitel 1 und 2). Weiter geht es biographisch mit Nietzsches Zeit an der Universität: ein Semester Theologie, Wendung zur Philologie, Berufung auf die Professur in Basel, Begeisterung für Wagner, Aufgabe der Professur (Kapitel 3 bis 5).
Die folgenden Kapitel sind thematisch orientiert. Hier kommt Nietzsches Christentumskritik ausführlich zur Sprache, für die er auch bekannt ist: Seine Kritik der Mitleidsmoral (auch der Nächstenliebe, die ja sonst als mit das Beste am Christentum wahrgenommen wird!) und des schlechten Gewissens (Kapitel 7 und 8) sowie seine Rede vom Tod Gottes (Kapitel 10). Doch auch die Ambivalenzen arbeitet Tietz heraus, so etwa seine bleibende Prägung durch die biblische Sprache und sein Schwanken im Verhältnis zu Luther (Kapitel 6), sowie Nietzsches ausdrückliche Wertschätzung für die Person Jesu (Kapitel 9).
Die inhaltliche Darstellung kulminiert in Kapitel 11 über den Übermenschen. Gerade hier, wo Nietzsche sich mit der Lehre von der ewigen Wiederkehr des Gleichen und des amor fati (Liebe zum Schicksal) vom Christentum zu emanzipieren scheint, arbeitet Tietz heraus, wie bei Nietzsche weiterhin die Fragen nach Vorsehung und Theodizee im Hintergrund stehen, die ihn seit seiner Jugend beschäftigten. Zum Ende wird das Buch wieder biographisch mit Nietzsches Zusammenbruch und Umnachtung (Kapitel 12).
Nietzsche und die Theologiegeschichte
Auffällig und kritikwürdig sind die wenigen Stellen, an denen Nietzsche von Tietz mit der Theologiegeschichte ins Verhältnis gesetzt wird. Die gesamte Theologiegeschichte bis zu Nietzsches Zeitgenossen wird dabei von nur zwei Gestalten repräsentiert: Augustinus und Luther. Augustinus erscheint immer als Negativfolie: Als Kronzeuge dessen, wovon Nietzsche sich (zu Recht?) abwendet (s. 114; 131) oder als Vertreter einer christlichen Lehre, die von Nietzsche transformiert wird (S. 91; 162f.). Bis auf eine Ausnahme werden dabei keine Quellen angeführt, stattdessen wird auf Lexikoneinträge verwiesen und an der ersten Stelle gibt es überhaupt keinen Beleg.
Martin Luther hingegen wird zum heimlichen Helden des Buches: Außerhalb der Abschnitte, in denen es spezifisch um Nietzsches Verhältnis zu Luther geht, wird er zweimal als positives Gegenbeispiel zu Nietzsches Kritik angeführt (S. 118; 130). Wirklich schief wird es beim historischen Referat zur Rede vom Tod Gottes (S. 150-152): Aus der Alten Kirche wird die Zwei-Naturen-Lehre genannt und die Irrlehre des Doketismus referiert – dass Gott am Kreuz den Tod auf sich nimmt, wird erst unter Rückgriff auf Luther entfaltet. Dass die Rede vom gekreuzigten Gott schon in der Alten Kirche gut belegt ist, bleibt unerwähnt. Außer in diesem letzten Zusammenhang fehlen auch zu Luther generell die Quellenbelege.
Der Umgang mit der Theologiegeschichte bleibt in „Nietzsche: Leben und Denken im Bann des Christentums“ also weit hinter dem Standard der Differenzierung zurück, mit dem Tietz Nietzsches Biografie und Denken vor- und darstellt. Wer sich aber quellennah und differenziert darüber informieren will, wie Nietzsche sich in Kritik und Wertschätzung mit dem Christentum auseinandergesetzt hat, ist mit dieser Darstellung gut beraten.
Christiane Tietz
Nietzsche
Leben und Denken im Bann des Christentums
C.H. Beck
249 Seiten
28 € (Hardcover), 23,99 € (E-Book)
Die grundsätzliche Freundlichkeit der Welt
Von Mario Keipert
„Wer bin ich und was will ich eigentlich?“
Eine große Frage, die sich vor allem in Krisen und Umbrüchen stellt, nicht ganz so sehr, wenn alles läuft. Solange äußere und innere Realität passen: alles in Ordnung. Aber jede:r erlebt es irgendwann im Leben: Es geht nicht mehr. So nicht. Jan Simowitsch hat das auch erlebt. Acht Jahre lang tobte er sich als Leiter des Popinstituts der Nordkirche aus, entwickelte Projekte, produzierte Musik, etwa für die populäre Reihe „Monatslied“, schrieb Oratorien oder Musicals, nahm CDs mit Klaviermusik auf, bildete Kirchenmusiker:innen aus. Klingt doch gut!

Jan Simowitsch (Foto: Johanna Degenstein)
„Es war eine erfolgreiche und wirklich schöne Zeit“, schreibt Jan Simowitsch in der Rückblende, „eine verdammt geile und zugleich unwirklich harte Zeit.“ Irgendwann wurde der Druck, wurden die Zwänge zu groß. Simowitsch, zu diesem Zeitpunkt Anfang 40, kündigt. Großer Umbruch, Aufbruch – nur wohin?
Es war ungefähr im gleichen Alter, da brach auch der Autor dieser Zeilen seine Zelte ab. Nach außen hin lief alles super, nur im Getriebe knirschte es. Zu viel Druck, zu viel Stress, zu wenig Sinn. Kündigung. Neuanfang. Und wie sicher bei vielen anderen Menschen auch waren es die „äußeren Zwänge“, die schnelle Antworten forderten: Was jetzt? In der Schublade liegt Plan B, der muss einfach passen. Wer bin ich? Was will, was brauche ich eigentlich? Welcher Job würde mich wirklich glücklich machen?
Fragen, für die wir uns viel zu wenig Zeit nehmen. Vielleicht genau die Zeit, die es braucht, um herauszufinden, dass solche Fragen eigentlich „Quatsch“ sind, wie Jan Simowitsch im Gespräch mit Vivian Pein im „yeet-Podcast“ erklärt: „Die Frage, wer bin ich, ist die dussligste, zeitvertreibendste Frage, die man sich überhaupt stellen kann.“
Auf den Spuren des Propheten Jona
Simowitsch macht nach seiner Kündigung „einen auf Jona“, packt die Fahrradtaschen und lässt sich vom Wal verschlucken. Er findet sich auf den Faröer Inseln wieder. Es ist April und Jan so ziemlich der einzige Tourist, der mit Fahrrad und Zelt die Inseln erkunden will. Runterkommen, nachdenken, Fragen beantworten, fernab des Internets: im Bauch des Wals. “Alles, was dich in den letzten Jahren so schwer gemacht hat, muss raus.“
Was Jan Simowitsch in den zwei Wochen auf den Faröer Inseln erlebt hat, davon erzählt er in seinem Buch „Und der Wal spuckt mich aus“. Er erzählt, so der Untertitel, „von einem, der auf Reisen ging, um sich selbst zu finden“. Wo der Prophet Jona vor Gottes Auftrag flüchtet und im – wahrscheinlich ziemlich unwirtlichen – Bauch des Wales eine unfreiwillige Auszeit nimmt, um letztlich Gottes Auftrag anzunehmen, sucht Simowitsch ganz bewusst die malerischen, aber von Wind und Wetter umtosten, einsamen Eilande fast am Ende der Welt auf: „Ich bin dann mal weg.“
Von seinen Plänen lassen Regen, Wind, einsame Nächte und hohe Berge schon bald nichts mehr übrig. Dafür hält jeder Tag neue Überraschungen bereit, und in der ungewohnten Freiheit zeigt sich eine Spur:
“Das Leben ist eine einzige, große Challenge, darauf zu vertrauen, dass dann etwas anderes kommt und dich weiterbringt. ‚Hab Vertrauen!‘ Das kann man sich immer mal wieder selbst sagen.“
Fehlende Badesachen, um in der Schwimmhalle des kleinen Städtchens Vágur zu schwimmen? Kein Problem! Das Handtuch gibt’s im Lebensmittelladen, Badehosen borgt man sich auf den Faröern einfach in der Schwimmhalle. Der Wind tobt um das Zelt, es regnet in Strömen? Gastfreundliche Inselbewohner laden Jan ein, in ihrem Haus zu übernachten. Bei der Gastgeberin handelt es sich noch dazu ausgerechnet um eine Pastorin, für deren Freundin der arbeitslose Kirchenmusiker tags darauf gleich einen Gottesdienst begleiten kann. Es zeigt sich: Manchmal braucht es gar keinen Plan.
“die Wege des Herrn / sind so unergründlich wie / der turm von luzern“,
dichtet Jan Simowitsch in einem der zahlreichen Haikus, die zusammen mit vielen Fotos seine Reiseerzählung begleiten. Eine Erzählung vom Glück, am Leben zu sein. Eine Erzählung über das immer wieder neue Staunen angesichts der Größe der Natur und dem Zufall, irgendwie immer mittendrin dabei zu sein.
Jan Simowitschs Variante über den Weg von Jona ist eine herrliche Improvisation über Vertrauen, Zuversicht und Freiheit. Mit großer Leichtigkeit und einer ordentlichen Prise (norddeutschen) Witzes empfiehlt er seinen Leser:innen noch dazu ein Inselvolk, das Sport, Kultur und Lebensfreude in sich vereint, das Fussballvereine und Männerchöre hervorbringt, die für ein solch kleines Volk eigentlich viel zu groß (und viel zu toll) sind.
Mit der Freundlichkeit der Welt rechnen lernen
Mag sein, dass Jan auf Reisen ging, um sich selbst zu finden. Was er findet, ist die Möglichkeit, mit der Freundlichkeit der Welt und der Menschen zu rechnen. Dass das Staunen und Wundern sich nicht verbraucht. Und man sich frei und geborgen zugleich fühlen kann. „Wenn man sich über etwas totdenken könnte, sollte man sich lieber für das Leben entscheiden“, denkt er irgendwann.
Und kehrt in seine Heimat zurück. Mitten ins Leben. Auftrag ungewiss. „Ich weiß auch heute noch nicht, was ich werden möchte.“ Ist auch nicht so wichtig. Fürs Erste hat er dieses Buch geschrieben, das inmitten einer stürmischen Gegenwart auf heilsame Weise von der Wiederentdeckung eines unerschütterlichen Vertrauens zeugt: “Soll der Ärger sich doch mit sich selbst rumplagen. Ich wähle das Leben.“
Jan Simowitsch
Und der Wal spuckt mich aus
Von einem, der auf Reisen ging, um sich selbst zu finden
bene!
192 Seiten
18 € (gebundene Ausgabe), 15,99 € (E-Book)
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.