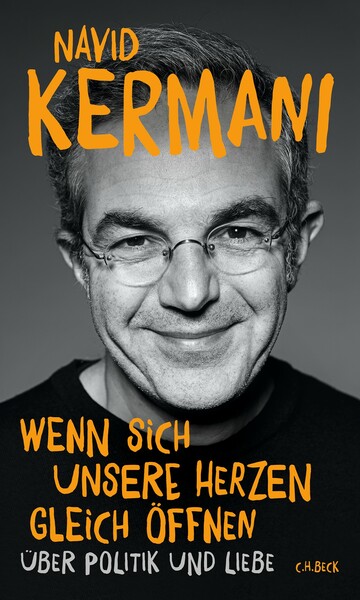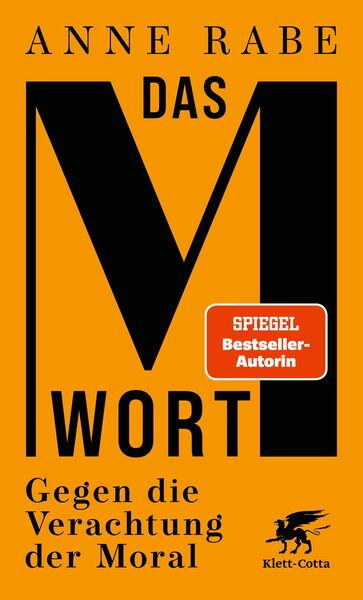Die Krise der bürgerlichen Moral
Navid Kermani und Anne Rabe schreiben über Liebe und Moral in der Politik. Können sie überzeugen? Worin gründet die bürgerliche Moral angesichts der Krisen unserer Zeit?
Die politische Rechte will die Moral in Verruf bringen. Nicht wenige sich als „bürgerlich“ verstehende Akteur:innen und Kommentator:innen stimmen in den Chor derjenigen ein, die an jeder Ecke des Diskurses „Moralismus“ wittern. Die Verteidiger:innen von liberalen, humanistischen Werten oder eines an der Religion geschulten gnädigen Menschenbildes lassen sich – so scheint es – von den „Hypermoral“-Vorwürfen einschüchtern.
Müsste die Moral nicht gerade angesichts von Rechtsruck, Trumpismus und multipler Krisen ein Comeback feiern? Wie finden wir Wege zum Anderen und wie werden Demokratie, Menschenwürde und Mitgefühl heute plausibel gemacht? Zwei aktuelle Sachbücher befassen sich mit der Moral in Politik und Gesellschaft: In „Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen“ schreibt Navid Kermani über „Politik und Liebe“. Anne Rabes neues Buch „Das M-Wort“ richtet sich gegen die „Verachtung der Moral“.
Give Me Love (Give Me Peace On Earth)
Von Philipp Greifenstein
In Navid Kermanis im August 2025 veröffentlichten Buch „Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen. Über Politik und Liebe“, das er dem kürzlich verstorbenen Philosophen und Dramaturgen Carl Hegemann gewidmet hat, sind sechs Reden und ein Brief versammelt, die von Kermani (mit einer Ausnahme) während der Jahre 2025 und 2024 verfasst wurden. Wir starten mit einem Brief des Autors an seine Tochter Raha zu ihrem 18. Geburtstag und enden mit seiner Rede an die Festgemeinde bei der Hochzeit seiner Tochter Ayda (vom Herbst 2022).
Diese beiden persönlichen – man darf sagen: privaten – Texte rahmen fünf Reden, von denen wiederum vier bereits in Zeitungen erschienen sind: Kermanis Rede auf dem Solidaritätskonzert „Jede:r ist jemand“ im Berliner Ensemble vom Juni 2024 in DIE ZEIT (€), seine Rede beim Demokratie-Konzert des Gewandhausorchesters Leipzig vom September 2024 ebenda, seine Trauerrede für Carl Hegemann in der taz, und die Dankesrede zur Verleihung des Thomas-Mann-Preises vom September 2024 wiederum in der ZEIT (€).
Die bisher unveröffentlichte Keynote beim Medienempfang des Hamburger Senats vom Mai 2025 unter dem Titel „Der Westen, in dem ich geboren bin“ beschließt den Reigen der politischen Reden. Mit 37 Seiten nimmt diese Rede in dem mit 141 Seiten Inhalt schmalen Bändchen reichlich Raum ein, fällt jedoch im Vergleich mit den kürzeren Reden qualitativ ab. Bevor Kermani die Keynote im letzten Absatz routiniert mit der Schilderung der längst angeteaserten Begegnung des Knaben Kermani mit Ajatollah Chomeini in seinem Pariser Exil abbindet, haben die Hörer:innen und Leser:innen eine, für Kermani untypisch, recht eklektische Tour d’Horizon durch die multiplen Krisen der Gegenwart mitmachen müssen.
Navid Kermani ist ohne Zweifel der gegenwärtig beste Rhetor Landes. Sein Umgang mit der deutschen Sprache ist virtuos. Er formuliert präzise, beschreibt trefflich und vermag es, mit Worten anzurühren. Kermani scheut die große Geste nicht und hat doch einen eigenen behutsamen und zärtlichen Sound. Kermani liebt die Sprache, die deutsche Sprache und Kultur. Auf dieser Ebene der Performanz führt das Büchlein also authentisch vor, was öffentlich vorgetragene Liebesbekundungen bewirken können. Eine seltene Ausnahme im politischen Diskurs.
Kermanis politische Diagnosen über das Schicksal des Westens, Europas und Deutschlands angesichts von Trumpismus und US-Isolationismus, des russischen Imperialismus und der mit beiden verknüpften Bedrohung durch den Rechtsradikalismus sind hingegen mehr oder weniger gewöhnlich. Selbst die Mahnung, der Westen verspiele durch die anhaltende Unterstützung des israelischen Krieges in Gaza seine Glaubwürdigkeit im Globalen Süden, auch und besonders in muslimischen Ländern, ist in den vergangenen Wochen aus dem Diskursschatten getreten.
Der Westen soll sich gegen Despoten stellen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit üben und sich liberale Traditionen, wie Geschlechtergerechtigkeit und Kunstsinnigkeit, erhalten. Die Kraft dazu sollen die Bevölkerungen und Regierungen des Westens finden, indem sie sich der eigenen kulturellen (Hoch-)Leistungen gewahr werden, die wie Beethovens Neunte aus dem Miteinander der Völker, Kulturen und Einflüsse entstanden sind. Wahrlich, wir haben viel zu verlieren.
Es sind Texte über Liebe und es sind Texte über Politik in diesem Buch zu finden, aber wie nun die Liebe in die Politik kommt, jenseits wirklich schöner Reden, auf diese Frage bleibt Kermani eine Antwort schuldig. Soll die Komposition des Bandes ein Hinweis sein? Sind die elterliche und romantische Liebe, die Kermani im Brief an seine Tochter Raha selbst zu erklären sucht, und die mit seiner Hochzeitsrede zum Schluss noch einmal eine Reprise erfahren, der politischen Sphäre nicht fremd, entrückt, sogar dankenswerter Weise enthoben? Gilt nicht Macht statt Liebe als das Kommunikationsmedium der Politik?
Gleicht die Demokratie in Deutschland wirklich einem frühgeborenen Kind, schön und zerbrechlich zugleich, unbedingt beschützenswert? Ist das Mitgefühl, das dem Menschen vorpolitisch innewohnt, und das Kermani an seinen Töchtern lobt, des Rätsels Lösung? Aber wie kann eine solche Liebe den Weg ins Politische finden, wenn sie doch – wie der gläubige Kermani zu Recht befindet – als „Offenbarung“, also dem Menschen prinzipiell unverfügbar, Eingang in unsere Lebenswirklichkeit findet?
„Eins sein mit allem, was lebt“ – Mit diesem „innigsten Wunsch“ Hölderlins ist Kermani zufolge „alles gesagt, was politisch notwendig wäre“. Eine solche religiös grundierte Ehrfurcht vor dem Leben ist im Albert-Schweitzer- und Martin-Buber-Jahr 2025 – beide verstarben vor 60 Jahren – ehren- und bedenkenswert, aber vermag sie in einer säkularisierten und individualisierten Gesellschaft auch zu tragen?
Aufgeschlagen habe ich „Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen“ auf der Suche nach einer Antwort darauf, was heute politisch zu tun ist, um den Herausforderungen der Zeit, die Kermani allesamt trefflich beschreibt, zu begegnen. Gerührt habe ich es wieder aus der Hand gelegt – aber auch mit Restzweifeln. Allein offene Herzen werden nicht genügen. So viel kulturbürgerlichen Optimismus wie Kermani bringe ich nicht zusammen.
Navid Kermani
Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen
Über Politik und Liebe
C.H. Beck
143 Seiten
20 € (Hardcover)
Gegen den Moralismusvorwurf
Von Tobias Graßmann
Trotz seines Titels handelt „Das M-Wort. Gegen die Verachtung der Moral“ von Anne Rabe nicht wirklich von Moral. Grundsätzliche Überlegungen zur Moral finden sich in dem Buch nur in wenigen Abschnitten. Ein „moralischer Grundkonsens der demokratischen Welt“ (S. 178) wird eher vorausgesetzt als ausbuchstabiert.
Anne Rabe hat vielmehr ein Buch über und gegen den Rechtsruck geschrieben – das titelgebende M-Wort müsste daher eigentlich Moralismusvorwurf lauten. Den nutzen wirtschaftsliberale, konservative und rechte Populisten bekanntlich gerne, um politische Gegner in die Rolle von unsympathischen Moralapostelinnen zu drängen und sich dem Volk als die vermeintlich entspannte Alternative anzubiedern.
Über weite Strecken des Buchs erzählt Rabe eine stattliche Anzahl von Stationen der jüngeren deutschen Geschichte nach. Die Spannbreite reicht von Weizsäcker-Rede und Historikerstreit über das sog. „Sommermärchen“ der WM 2006 und die Flüchtlingsbewegungen seit dem Jahr 2015 bis zur jüngsten Bundestagswahl und Diskussionen auf Bluesky. Dabei entsteht das Bild einer fortschreitenden Rechtsverschiebung der deutschen Gesamtgestimmtheit, wobei in rückblickender Bewertung vieles ein bisschen eindeutiger erscheinen darf, als es damals wahrscheinlich gewesen ist.
Das Ergebnis: Man weiß seit Langem, wie man mit Faschisten umzugehen hätte – aber die Politik verweigert sich ihrer Verantwortung. Und die Presse, die Gesellschaft? Lassen sie damit davonkommen.
Unterbrochen wird der Durchgang durch die Zeitgeschichte von poetisch-tagebuchähnlichen Selbstzitaten. Die fett und kursiv gesetzte Bitte, als Mann das Kapitel zum Fall Pelicot nur nicht zu überblättern, sollte man sich unbedingt zu Herzen nehmen! Andernfalls verpasst Mann ein besonders gelungenes Kapitel (das auch gut als eigenständiger Essay funktioniert hätte). Lesenswert ist es gerade deshalb, weil hier die unhintergehbare Ambivalenz von Moral als Beschämung und die blinden Flecken unserer Alltagsmoral aufscheinen. Die Moral, auf die wir uns stützen, ist eben durch patriarchale Vorurteile sowie eine fundamentale Ungleichstellung von Männern und Frauen verzerrt.
Rabe vermeidet im „M-Wort“ ansonsten weitgehend die Auseinandersetzung mit den Ambivalenzen, Schattenseiten und repressiven Tendenzen von Moral und Moralismus. Moralisch sein wird sehr einlinig mit progressiv, linksliberal und demokratisch gleichgesetzt – der Moralismusvorwurf spielt nur als rechte Stimmungsmache und Diffamierungsversuch eine Rolle. Aber könnte es nicht sein, dass die Attraktivität der Rechten gerade aus einem Mischmasch von Moralismus und Moralverachtung herrührt – weil evangelikale purity culture und Trumps „Grab em by the pussy!“ eben zwei Seiten derselben patriarchalen Medaille sind?
Weshalb genau scheint die Doppelmoral der Rechten gegen den Vorwurf der Widersprüchlichkeit immun zu sein? Und warum ist die linke Verbindung von Moralkritik und Moralismus heutzutage gerade bei denen so unbeliebt, für die man sich politisch einsetzen möchte? Man wird beim Lesen den Eindruck einer gewissen Ratlosigkeit nicht los, warum das progressive Lager mit seinen Antworten und seiner Moral einfach nicht mehr durchzudringen vermag. Einen interessanten Hinweis bietet Rabe mit dem Verweis auf die „Transformationserfahrungen vieler Bürgerinnen und Bürger“ (S. 157). Dazu würde man gerne mehr lesen und kann dafür wohl die literarischen Auseinandersetzungen der Autorin mit der ostdeutschen Geschichte heranziehen.
Den Kern des Moralischen sieht Rabe in der „Bekämpfung der Ungleichheit“ (S. 164): „Ich habe eine Vorstellung von einer besseren, einer gerechteren Welt. Und ich weiß, dass die Gerechtigkeit eine Hilfe auf dem Weg zu mehr Gleichheit ist. Dass die Gleichheit eine Voraussetzung ist, die Gesellschaft immer wieder, immer weiter zu verbessern.“ (S.165 f.). Gleichheit klingt allerdings erst einmal recht abstrakt und der Satz, dass alle Menschen gleich sind, erscheint in dieser Abstraktheit sogar unmittelbar falsch. Rabe präzisiert folglich hinsichtlich des Wertes und der Würde: „Die Gleichheit an Wert und Würde aller Menschen, die schlichte Annahme, dass mein Gegenüber der gleiche Mensch wie ich ist, kann der Kompass für unser Handeln sein.“ (S. 178 f.).
In dieser Schlichtheit bleibt die geforderte Moral leider irgendwie blass. Woher kommt die „Gewissheit, dass alle Menschen gleich an Wert sind“ (S. 201)? Wie lässt sich diese Gleichheit begründen, welche menschliche Eigenschaft steht für sie ein, welche Instanz verpflichtet uns auf sie, welche Erzählungen können uns als Modell dienen? Rabes Antwortversuche wirken aus meiner christlich-religiösen Perspektive etwas umständlich – und teilweise auch verzagt.
Wahrscheinlich ist das typisch für einen säkularen Humanismus, der eine emotional leicht unterkühlte Moral tragen soll, die sich leider weder evolutionsbiologisch noch zweckrational plausibel machen lässt. Mutmachende Beobachtungen aus der ostdeutschen Provinz können das Gewicht der Hoffnung nicht stemmen, weshalb Rabe in eine Art Verzweiflung an der Verzweiflung kippt: Zum Aufgeben ist es auch schon zu spät! Der Christ steht hier an der Seitenlinie, wirft die Hände in die Luft und rauft sich die Haare: Wie wäre es mit der Gottesebenbildlichkeit? Eine Pastorin hätte den verwandelt.
Anne Rabe
Das M-Wort
Gegen die Verachtung der Moral
Klett-Cotta
224 Seiten
20 € (Hardcover)
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.