
Zwischen Seelengewinn und Melancholie
Adam Bernd war Bildungsaufsteiger und ein vielversprechender Universitätsdozent, bis sein Pseudonym „Christian Melodius“ offenbart wurde. Lange vergessen, verdankt die Nachwelt ihm einen der ersten entwicklungspsychologischen Romane.
Breslau, im Jahr 1686. Ein in der Stadt einquartierter Soldat erwischt den zehnjährigen Sohn seines Gastgebers beim Lauschen. Er stürzt ihm hinterher, schlägt nach ihm. Beinahe gelingt es ihm, das Kind zu töten. Am nächsten Tag sucht er nach dem Jungen, doch der hat sich bei den Nachbarn versteckt. Der Soldat zieht weiter, das Trauma blieb dem Kind jedoch.
Knapp fünfzig Jahre später veröffentlicht der Junge von einst seine Geschichte. Adam Bernd, inzwischen umstrittener Theologe in Leipzig, will die Krankheiten beschreiben, die ihn seit seiner Kindheit plagen. Das Ergebnis: Eine knapp 800-seitige Lebensbeichte und eine der detailliertesten Schilderungen psychischer Erkrankungen der Vormoderne in deutscher Sprache. Dieses Buch, die „Eigene Lebens-Beschreibung“ (1739) wird Bernds Vermächtnis.
Besonders groß ist dieses Vermächtnis aber nicht. Bernd gilt als untalentierter Schriftsteller. Ein Literaturwissenschaftler wird seinen Text als „nur in kleinen Teilen lesbar“ bezeichnen. Neben der Medizin wird die Literaturwissenschaft Bernd etwas Aufmerksamkeit widmen, vorrangig aufgrund der inhaltlichen Nähe zu Karl Phillip Moritz‘ Klassiker „Anton Reiser“. Dieser Bezug erwies sich für Bernd als Segen und Fluch. Einerseits verdankt er die wenige Aufmerksamkeit der Forschung Moritz‘ Roman, andererseits verdeckte das Interesse am Romanautoren Bernd seine vielschichtigere publizistische Karriere.
Unter seinen Zeitgenossen war Bernd in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich: Ein Bildungsaufsteiger, Protagonist eines Skandals und ein außergewöhnlicher Autor. Dem literarisch experimentierfreudigen Theologen verdanken wir nicht nur einen der ersten entwicklungspsychologischen Romane, sondern auch einen Einblick in die binnenkonfessionelle Vielfalt im Protestantismus um 1700.
Seine Geschichte nimmt ihren Ausgangspunkt in Breslau. Dort wächst Bernd als Sohn eines Kohlgärtners auf, also eines städtischen Bauern. Der Vater ist Katholik, die Mutter eine eifrige Lutheranerin und nach Bernds eigenen Aussagen Pietistin. Im gemischtkonfessionellen Breslau wurde Bernd zunächst katholisch getauft, aber aufgrund seiner Begabung als Schüler in das städtische Elisabethen-Gymnasium aufgenommen. Auch hier gelang es Bernd, sich hervorzutun. 1699 erhält der Schüler ein Stipendium für die Universität Leipzig.
Bernd hatte es anscheinend geschafft: 1701 machte er sein Examen und war danach als Dozent für Hebräisch und als Hauslehrer in Leipzig angestellt. In Leipzig war der junge Dozent zunächst beliebt, auch als Prediger gehörte er zu den populärsten Theologen Leipzigs. Beides sollte sich im Laufe der Jahre ändern.
Die Melodius-Affäre
Die Wertschätzung blieb nicht von Dauer: Bereits in seiner Schulzeit zeichnete sich ab, dass der angehende Theologe Misstrauen hervorrief. Orthodoxen Lutheranern erschien Bernd als Pietist, während er in den pietistischen Kreisen als strenger orthodoxer Lutheraner galt. Beides ist so sehr richtig, wie auch falsch. Bernd las und rezipierte insbesondere August Herrmann Francke; seine Autobiographie und andere zeitgenössische Äußerungen legen jedoch eine Distanz zwischen Bernd und dem Hallischen Pietismus nahe.
Diese Distanz beruhte auch auf Gegenseitigkeit. Pietisten und orthodoxe Lutheraner gleichermaßen verhinderten Berufungen auf lukrativere Stellen, weil ihnen Bernds theologische Verortung suspekt schien. Ein bleibender Verdacht, den er mit seinen Publikationen nicht ganz ausräumen konnten. Selbst seine ehemaligen Förderer verhinderten eine Anstellung, weil sie Unruhen im Falle einer Berufung befürchteten.
Bernds Stellung zwischen allen inner- und außerkonfessionellen Stühlen wurde zunehmend dadurch verkompliziert, dass er im Privaten durchaus ambitionierte konfessionelle Projekte entwarf. Als ehemaliger Katholik schien er sich Sympathien für seine alte Konfession erhalten zu haben. Die Tatsache, dass er Schlesien, eine konfessionell diverse Region, als Heimat hatte, dürfte einen gewissen Pragmatismus in Streitfragen zwischen Luthertum und Katholizismus begünstigt haben.
1728 erschien unter dem Pseudonym „Christian Melodius“ eine Schrift mit dem Namen „Einfluss der göttlichen Wahrheiten in den Willen und das Leben der Menschen“. In dem Traktat sprach sich Bernd für eine Verständigung von katholischer und lutherischer Konfession aus. Derartig geäußerte Hoffnungen waren am sich keineswegs undenkbar, aber bewegten sich theologisch auf dünnem Eis, vor allem ohne politische Protektion, über die Bernd aber nicht verfügte. Bernd vertrat die Ansicht, Abweichungen zwischen Katholizismus und Luthertum wie Abendmahl und Heiligenverehrung seien bloße Meinungsunterschiede, die aber keine tiefgehenden Verständigungshindernisse darstellten.
Gegen den Verfasser mobilisierte schon bald das theologische Establishment Kursachsens. Insbesondere Valentin Ernst Löscher, Herausgeber der Zeitschrift „Unschuldige Nachrichten“ und einer der publizistisch wirkmächtigsten Vertreter der lutherischen Orthodoxie, ritt publizistische Attacken gegen den unbekannten Verfasser. Bernds Tarnung flog auf: Sein Verleger Heinisius nannte ihn als Urheber der Schriften und er verlor noch im gleichen Jahr seine Anstellung als Dozent. In einem von Loescher publizierten Brief widerrief Bernd seine Thesen.
Ein Psychopath?
Seine Bemühungen um Rehabilitation dürften wohl der Anlass für die „Eigene Lebens-Beschreibung“ gewesen sein, die zehn Jahre nach der Melodius-Kontroverse unter Bernds Namen in Leipzig erschien. Bernds Anliegen war es, sich vor der Öffentlichkeit Leipzigs als rechtgläubiger Lutheraner zu präsentieren. Jedoch war die „Eigene Lebens-Beschreibung“ mehr als nur eine Apologie einer gescheiterten theologischen Gelehrtenexistenz.
Bereits in früheren Schriften hatte sich Bernd mit protopsychologischen Themen befasst. Resultat dieses Interesses war eine strukturierte Lebensbeichte, die einen umfassenden Blick auf die theologische und philosophische Verarbeitung psychischer Erkrankungen aus der Sicht eines Betroffenen ermöglicht. Nach Jahren geordnet handelt Bernd seine Erlebnisse, seine Ängste, seine Sündhaftigkeit und seine Depressionen ab.
Ein solcher Text entsteht nicht im luftleeren Raum: August Herrmann Franckes berühmter Konversionsbericht stand wohl bei der Strukturierung Pate, jedoch löste sich Bernd vom Bekehrungsschema Franckes in einer Weise, die Anne Lagny einst als „missglückt“ bezeichnete. Wie bei Francke erlebt Bernd seine seelischen Anfechtungen in Gestalt der Sünde gestuft, „von der Anfechtung des Fleisches bis zur Anfechtung der Welt“ (Langny). Während Franckes Lebensweg fluchtpunkthaft auf das Bekehrungserlebnis zuläuft, verzettelt sich Bernd, weil sein Erleben sich vergleichbaren Kategorien entzieht. Bernds Leben und Psyche ließen sich eben nicht für eine Triumpherzählung funktionalisieren, sondern zeichnen das Bild einer Innerlichkeit, die einfach nicht zur Ruhe kommen kann.
Bernds Lebensbeschreibung wäre schon allein als religiöse Autobiographie ein bemerkenswerter Text. Doch seine Seelenleiden, Depressionen und sein Umgang mit ihnen führten ihn dazu, die Seelenleiden philosophisch und psychologisch zu verstehen und literarisch fassen zu versuchen. So ließ Bernd auch populäre Fall- und Arztgeschichten über Melancholie in den Text einfließen. Er erzählt von Gemütszuständen, die man heute wohl als Depressionen und Angststörungen bezeichnen würde. Bernds Umsetzung dieser Geschichten geht jedoch weit über die Vorbilder hinaus. Bernds „Eigene Lebens-Beschreibung“ bildet dadurch ein Bindeglied zwischen religiöser Autobiographie und dem frühen entwicklungspsychologischen Roman.
Adam Bernd und seine Schriften haben den Eingang in den kirchenhistorischen und/oder literarischen Kanon weit verfehlt. Die Geschichte des psychologischen Romans und sein Verhältnis zur Autobiographie beginnt in vielen Literaturgeschichten mit Karl Phillip Moritz‘ „Anton Reiser“. Sein Leben zwischen allen theologischen und literarischen Konventionen seiner Zeit, macht eine klare Zuordnung schwierig – und müsste ohnehin stärker erforscht werden.
Dabei würde sich das sicher lohnen: Aus Bernds bis heute nur unzureichend bearbeitetem Werk spricht eine bemerkenswerte Bandbreite innerprotestantischer Diskurse um das Jahr 1700. Gleichzeitig entzieht sich genau diese Vielfalt auch heute noch populären Analysekategorien wie „Lutherische Orthodoxie“, „Pietismus“ und „Aufklärung“. Trotz aller Differenzierungen zwischen innerlicher Erweckung und geistlosem Altprotestantismus krankt der Blick auf Bernd bis heute an Vereinnahmungsversuchen pro und contra Pietismus. Bernd war jedoch im besten Sinne ein Theologe der Zwischenräume. Und diese nicht näher zu untersuchen, wäre furchtbar schade.
mind_the_gap – Vergessene Kapitel der Kirchengeschichte
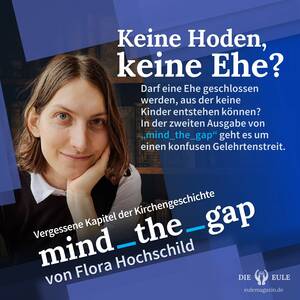 Flora Hochschild stöbert für uns in den Untiefen der frühneuzeitlichen Kirchengeschichte und kramt aus dem Schatz der Historie erstaunliche Episoden hervor: In der Serie „mind_the_gap“ geht es im Frühjahr / Sommer 2024 um vergessene Kirchengeschichte(n), gottesfürchtige Abenteurer:innen und verborgene Wahrheiten. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!
Flora Hochschild stöbert für uns in den Untiefen der frühneuzeitlichen Kirchengeschichte und kramt aus dem Schatz der Historie erstaunliche Episoden hervor: In der Serie „mind_the_gap“ geht es im Frühjahr / Sommer 2024 um vergessene Kirchengeschichte(n), gottesfürchtige Abenteurer:innen und verborgene Wahrheiten. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.

Mitdiskutieren