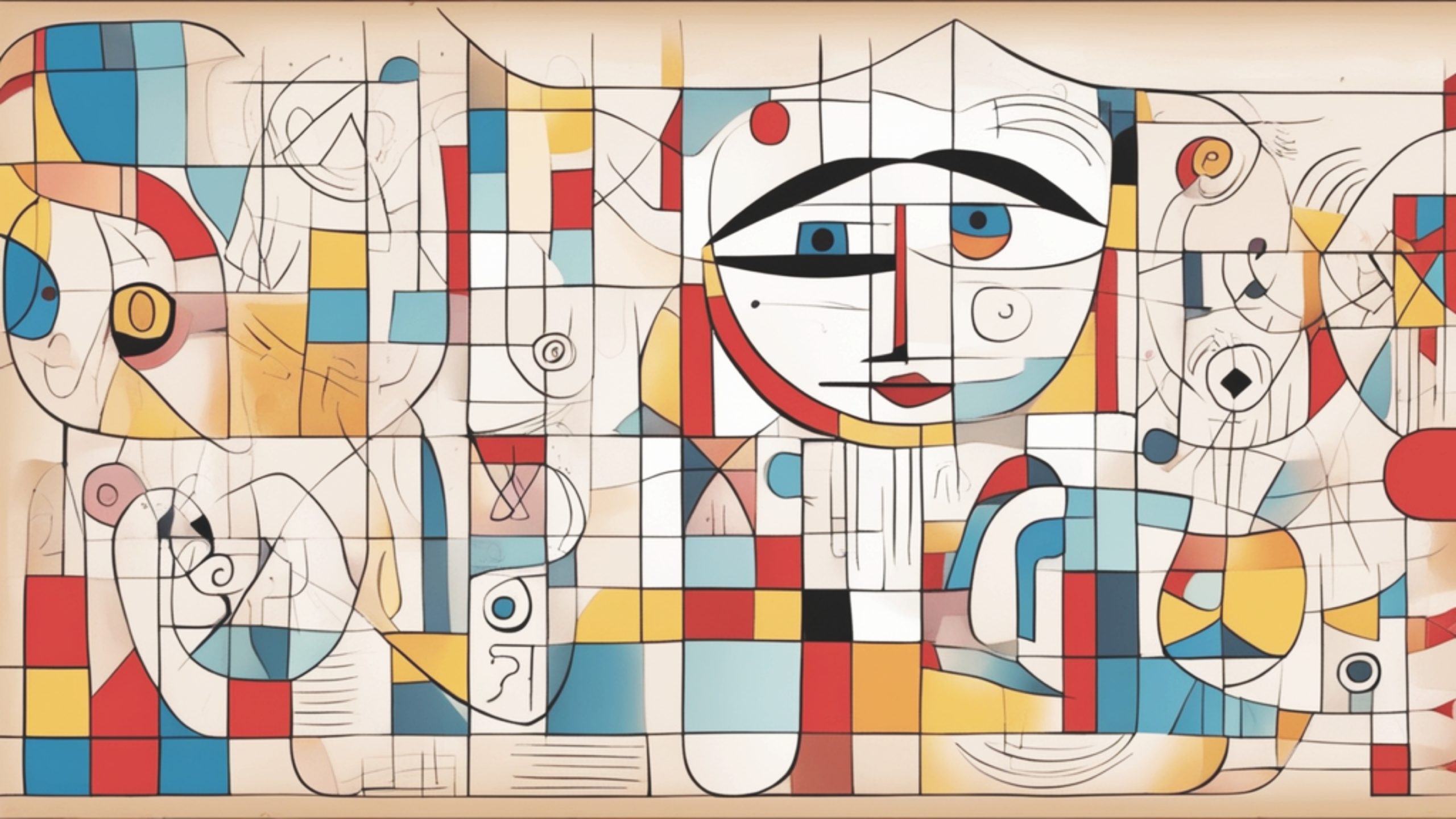
#digitaleKirche: Social-Media-Trends Update 2023
Mit welchen Social-Media-Trends müssen #digitaleKirche-Akteur:innen gegenwärtig rechnen? Wie geht es mit den großen Social-Media-Plattformen weiter? Und wo finden christliche Angebote ihre Zielgruppen?
Das Leben in der Digitalität ist bunt und vielfältig, kann manchmal aber auch unübersichtlich werden. Digitale Werkzeuge sind integrale Bestandteile unseres Alltags: Bis ins hohe Lebensalter hinein werden digitale Medien konsumiert und Kontakte zu Freunden und Familie digital gehalten. In den jüngeren Alterskohorten werden digitale Begegnungen ebenso intensiv gelebt wie analoge. Was ist los in Social Media und wie können christliche Akteur:innen darauf reagieren?
Inhalt
- Der Abschied vom Web 2.0
- Mehr Sicherheit auf Social-Media-Plattformen?
- Plattformübersicht: Wen will ich wo erreichen?
- Brauchts des alles? Nein, aber …
- Vom Feeling her ein ungutes Gefühl
Die Landschaft digitaler Begegnungsorte hat sich in den vergangenen Jahren erheblich ausdifferenziert: Die „klassischen“ Sozialen Netzwerke sind nur noch ein Gebiet neben anderen, das digital natives als Zuhause dient. Messenger, als eigenständige Apps und als Teil von Plattformen, sind heute vielfach lebendigere soziale Orte als die von den Plattformen ins Zentrum ihres Angebots gestellten Feeds. Vor allem Jugendliche pflegen ihre sozialen Kontakte auch in Multiplayer-Games. Der Trend zum (Kurz-)Video macht aus Plattformen wie TikTok und Instagram Konsument:innen-Medien. Geht es nach den Unternehmenschefs, soll es auch auf Facebook und Twitter/X in diese Richtung gehen.
Social-Media-Plattformen verändern sich ebenso wie das Verhalten der Nutzer:innen und die Ansprüche der Plattformökonomie. Die treibende Kraft hinter diesen Veränderungen ist nur in den seltensten Fällen die utility (der Nutzen) für einfache Bürger:innen in der digitalen Gesellschaft. Mit den Interessen von Nutzer:innen und Produzent:innen kollidieren irgendwann die kommerziellen Interessen der Plattformbetreiber. Das jedenfalls ist eine Lehre aus der inzwischen zwanzigjährigen Geschichte der „klassischen“ Sozialen Netzwerke (s. „The ‘Enshittification’ of TikTok: Or how, exactly, platforms die“ von Cory Doctorow, WIRED, auf Englisch)
Der Abschied vom Web 2.0
Noch vor wenigen Jahren haben Internet-Enthusiasten von Prosumenten (prosumer) geschwärmt: Mediennutzer:innen, die zugleich Konsument:innen und Produzent:innen sind. Das Web 2.0 als Idee setzt Nutzer:innen voraus, die eine aktive Rolle als Mitgestalter:innen der zirkulierenden Inhalte übernehmen. Wichtigstes Werkzeug und Schauplatz dieser „klassischen“ Sozialen Medien ist der social graph, d.h. die Anordnung von Inhalten nach Maßgabe der Beziehungen der Accounts untereinander. Dabei ist es egal, ob es sich um Personen, Organisationen oder Unternehmen handelt. Auf dieser Grundlage funktionieren sowohl RSS-Feeds von Blogs und Blogrolls als auch die (chronologischen) Feeds auf Mastodon, Instagram und Twitter/X. Die Nutzer:innen entscheiden durch bewusste Aktionen – z.B. eine Freundschaftsanfrage oder einen Follow -, wem sie folgen und wessen Inhalte sie konsumieren wollen („in die Timeline holen“).
Durch ihre Entscheidungen setzen sich die Nutzer:innen selbst in ein Verhältnis zu anderen Accounts. Gemeinsame Interessen oder die bereits bestehende analoge Bekanntschaft stehen zwar häufig am Anfang, bilden aber keineswegs das einzige Kriterium dafür, einen Kanal in das eigene Netz zu holen. Dass man mit der Zeit auch Inhalte mitbekommt, die jenseits des eigenen (bisherigen) Interesses liegen, macht den social graph so nachhaltig lohnend für die Nutzer:innen – und unberechenbar.
Für Content-Produzent:innen, allzumal wenn sie im Auftrag einer Organisation oder eines Unternehmen kommunizieren, stellt der social graph deshalb eine große Herausforderung dar. Weil er zudem zwingend die Interaktion mit Follower:innen verlangt, besteht „klassische“ Social-Media-Arbeit nicht allein aus der Content-Produktion, sondern vor allem aus Community-Management. Ziemlich viel Aufwand, um Werbebotschaften an die Konsument:in zu bringen. Weil (vor allem) die Unternehmen innerhalb der Nutzer:innenschaft für die Plattformen als potentielle Werbekunden von Bedeutung sind, stellen sie ihnen Werkzeuge zur Verfügung, um den Weg zu ihren Zielgruppen auf den Plattformen abzukürzen (z.B. targeted advertising).
Werbung kann nur dann auf Erfolg hoffen, wenn sie Teil eines positiven Nutzungserlebnisses ist. Für die Plattformbetreiber ergibt sich daher die Notwendigkeit, die Plattform so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen sie möglichst lange und intensiv nutzen. Dabei steht nicht der Gewinn der einzelnen Nutzer:in, sondern derjenige der werbenden Unternehmen im Fokus des Plattformdesigns. Gleichwohl gibt es auch ein zu viel des für die Werbetreibenden Guten: Die Werbung muss sich möglichst unauffällig und ganz im Stil der Plattformkonventionen einfügen (native advertising). Attraktiver als Text-, Bild-, Ton- oder Videoanzeigen, die klar als Werbung zu identifizieren sind, sind darum das Influencing und die algorithmische Verstärkung werblicher Kommunikation.
Ihre Zuspitzung und zugleich absolut zweckmäßige Umsetzung erfährt diese Strategie im Abschied vom social graph zugunsten eines algorithmisch erzeugten interest graph. Damit ist die Zusammenstellung der Inhalte für Plattform-Nutzer:innen anhand ihrer Interessen und Neigungen gemeint, die wiederum an ihrem eigenen Nutzungsverhalten auf der Plattform abgelesen werden. Diese Arbeit wird nicht händisch erledigt, sondern von den ominösen Algorithmen, also programmiertem Code. Der Star unter den Social-Media-Plattformen ist derzeit TikTok, dessen Algorithmus als besonders treffend beschrieben wird. Er gibt Änderungen des individuellen Nutzungsverhaltens außergewöhnlich sensibel wieder. Alle großen Social-Media-Plattformen arbeiten derzeit an der stärkeren Integration eines TikTok-artigen interest graph. Das Prosumenten-Versprechen des Web 2.0 ist damit weitgehend verabschiedet.
Die Frage, wer den Abschied von social graph vor allem befördert hat, stellt dabei ein Henne-Ei-Problem dar: Denn auch in (weitgehend) ohne Algorithmen zusammengestellten social graph-Netzwerken beteiligte sich nur ein Bruchteil der Nutzer:innen aktiv an der Content-Produktion. Insbesondere Bild- und Videoplattformen wie YouTube und Instagram sind seit jeher Konsument:innen-Plattformen, auf denen Interaktionsmöglichkeiten nur rudimentär ausgebaut sind. Im Zentrum steht hier die Inhaltesteuerung durch Likes, die durch im Hintergrund erhobene Marker, wie z.B. die Verweildauer, ergänzt wird. Das zählbare user engagement in diesen Apps verdankt sich nicht allein der Qualität der Inhalte, sondern dem Plattformdesign. Überspitzt gesagt: Der Mensch ist vermutlich kein Prosument und wir bekommen die Plattformen, die wir – mindestens unterbewusst – wollen.
Mehr Sicherheit auf Social-Media-Plattformen?
Die Gefahren algorithmisch zusammengestellter interest graphs wurden inzwischen vielfach beschrieben. Denis Groß hat am Beispiel TikTok auf Belltower.News die Dynamik anhand neuerer Forschungen nachgezeichnet:
„Die Gefahr in ein sogenanntes „rabbit hole“ (dt. „Kaninchenbau“) zu geraten, also nur noch Inhalt aus gewissen Themenbereichen angezeigt zu bekommen, ist dabei extrem hoch. […] Durch die Filterblase nehmen Nutzer*innen diesen Ausschnitt als vermeintliche Wahrheit oder Normalität wahr, da sie kaum mehr Inhalte angezeigt bekommen, die nicht in ihr Weltbild passen.“
Nach der Normalisierung, in der Nutzer:innen mit radikalen Inhalten in Kontakt kommen, wobei „der eigentliche Inhalt oftmals durch Witz und Ironie oder andere plattformspezifische Ästhetik (Trends, Challenges, etc.) verschleiert“ wird, folgt eine Phase der Gewöhnung (Akklimatisierung) und als Abschluss der Radikalisierung die Dehumanisierung, die wiederum den Weg „zu einem potenziellen Handlungsdrang, z.B. in Form einer Gewalttat,“ ebnet.
Auch wenn natürlich nicht jede:r Nutzer:in, die einmal ins rabbit hole von Kurzvideo-Feeds abgetaucht ist, sich politisch radikalisiert, ist damit eine Gefahr insbesondere für unbedarfte, jugendliche und anderweitig vulnerable Nutzer:innengruppen beschrieben. Das erhebliche Suchtpotential der Kurzvideo-Feeds von TikTok, Instagram und YouTube spüren auch Gelegenheitsnutzer:innen am eigenen Leib. Inbesondere bei Jugendlichen hat eine intensive Nutzung dieser Angebote negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das seelische Wohlbefinden.
Social Media als Gefahr für Demokratie und Gesundheit der Bevölkerung hat insbesondere in Europa und den USA die Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Seit Ende August 2023 gilt die erste Stufe des Digitale-Dienste-Gesetzes der Europäischen Union, das zunächst die großen Social-Media-Plattformen zu mehr Transparenz und Sicherheit verpflichtet. Demnach müssen u.a. die Meta-Plattformen Facebook und Instagram sowie die Google-Dienste, TikTok und Twitter/X einen Opt-Out aus der algorithmischen Zusammenstellung ihrer Angebote zwingend anbieten. Außerdem haben die Nutzer:innen in der EU ein „Recht auf Moderation“ und die Plattformen müssen stärker gegen systemische Risiken vorgehen. Alexander Fanta und Ingo Dachwitz von netzpolitik.org haben die Neuerungen dort erklärend zusammengefasst.
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, wusste schon Hölderlin, doch sind die Nutzer:innen gut beraten, sich beim Schutz vor Missbrauch, Radikalisierung und Plattformmacht nicht allein auf den Gesetzgeber zu verlassen. Es kommt auch auf das Verhalten mündiger Nutzer:innen an, soll den negativen Folgen des Lebens in der Digitalität gewehrt werden. Kinder und andere schutzbedürftige Gruppen müssen von anderen Nutzer:innen aktiv in Schutz genommen werden. Wie das ausschauen kann, beschreibt am Beispiel problematischer Kurzvideos Carla Siepmann in einer aktuellen Kolumne ebenfalls bei netzpolitik.org.
Für christliche Akteur:innen und die Kirchen stellt sich auch 2023 die große Frage, wie sie sich als Teil der europäischen digitalen Zivilgesellschaft positionieren. Es ist nicht damit getan, den Kirchenlobbyisten in Berlin und Brüssel mit auf den Weg zu geben, sich bei Parlamenten und Regierungen für eine menschenwürdige Digitalisierung einzusetzen. Das konkrete Handeln von kirchlichen Organisationen und christlichen Personen auf den Social-Media-Plattformen muss mit den hehren Forderungen nach informationeller Selbstbestimmung und einer sicheren Plattformgestaltung in Einklang gebracht werden.
„Wir müssen dahin, wo die Leute sind“ war jahrelang das vorherrschende Mantra von #digitaleKirche-Akteur:innen, wenn es darum ging, in den Kirchen für ein stärkeres kirchliches Engagement auf Social-Media-Plattformen zu werben. Auch wenn es richtig bleibt, dass sich die Kirche und ihre Haupt- und Ehrenamtlichen nicht in ihre eigene Welt zurückziehen, sondern öffentlich wahrnehmbar digital kommunizieren sollten, wird doch auch deutlich: Diese Anstrengungen bedürfen der fortlaufenden kritischen Überprüfung, an deren Ende auch die Erkenntnis stehen kann und darf, dass eine digitale Plattform zu toxisch ist, als dass man auf ihr noch sinnvoll das Evangelium kommunizieren könnte.
Plattformübersicht: Wen will ich wo erreichen?
Der Strom an neuen Akteur:innen reißt trotz aller Probleme mit den großen Social-Media-Plattformen nicht ab, die dort mit Menschen in Kontakt treten oder in Verbindung bleiben wollen. Welche Plattform oder App dafür geeignet ist, entscheidet sich im Blick auf die Zielgruppe des Angebots. Deshalb ist die Frage danach, welche digitalen Orte für Konsument:innen attraktiv sind, trotz des Abschieds vom Web 2.0-Mindset grundsätzlich wichtig. (Professionell agierende) Produzent:innen sollten dort senden, wo die Menschen schon sind, an die sich ihre Inhalte richten.
Es hat sich eingebürgert, die Plattformnutzung mit Hilfe von Alterskohorten zu beschreiben. Solche Analysen reproduzieren das aus der (analogen) Medienwelt bekannte Denken in „werberelevanten Zielgruppen“. Sie lassen häufig eine detaillierte Betrachtung von Interessen und Milieus außer Acht. Jugend gilt dann schnell als Trumpf. In den vergangenen Jahren sind auch #digitaleKirche-Akteur:innen einem „datengestützten“ Jugendwahn zum Opfer gefallen: Social-Media-Formate für ältere Zielgruppen werden kaum entwickelt und das Engagement bündelt sich auf Plattformen, die vor allem von jüngeren Zielgruppen genutzt werden. Dort wird man erhebliche Teile der Kirchenmitgliedschaft aber nicht ansprechen können.
Facebook: Immer noch relevant
Dass in den westlichen Industrieländern weniger Mitglieder der Generation Z (1997-2009) und Y („Millennials“, 1983-1996) den Weg auf Facebook finden, hat bereits zu vielen Abgesängen auf die weltweit größte Social-Media-Plattform geführt. Dabei wächst die Nutzer:innenschaft von Facebook insgesamt weiterhin an. Facebook ist keineswegs ein reines „Alte-Leute“-Medium, wenngleich man dort gegenwärtig mit Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene sicher nicht auftrumpfen kann. Social-Media-Angebote oder -Kampagnen, die sich an Erwachsene richten, werden auf Facebook aber weiterhin nicht verzichten wollen. Es sei denn, wichtige inhaltliche und ethisch-moralische (oder datenrechtliche) Gründe sprechen gegen ein Engagement. Facebook spielt auch in Deutschland weiterhin eine große Rolle, wenn es darum geht, Angebote vor Ort und im Sozialraum sichtbar zu machen (s.u.).
Instagram: Lebensraum und Gefahrengebiet
Im Vergleich zu Facebook ist das Publikum auf Instagram jünger, doch sollte man sich nicht täuschen lassen: Auch auf Insta überwiegen mit Generation Y und X („Generation Golf“, 1966-1982) die Erwachsenen. Das deutschsprachige Instagram ist im Vergleich zu anderen Plattformen wie Twitter/X, Mastodon und Facebook auch deutlich weiblicher. Das gilt im besonderen Maße noch einmal für die christlichen Bubbles auf der Bild- und Videoplattform des Meta-Konzerns. Gegen ein Engagement auf Insta sprechen die gleichen Gründe wie bei Facebook. In jedem Fall werden sich Content-Produzent:innen auch jenseits der Frage nach „Ja oder Nein“ überlegen müssen, welche Funktionen der inzwischen zu einer Jahrmarkts-App umgebauten Plattform sie überhaupt sinnvoll nutzen können.
Die Hoffnung auf große Reichweiten wird man begraben müssen. Das gilt insbesondere für christliche Influencer:innen und Projekte. Auch die größeren „Sinnfluencer:innen“-Kanäle im deutschsprachigen Raum sind in den vergangenen Monaten merklich an eine unsichtbare Decke der Reichweitensteigerung und des user engagements gestoßen. Weiteres Wachstum scheint nur möglich, indem man (wie auch auf Facebook) durch Werbeschaltungen massiv in künstliche Reichweite investiert. Neuere Untersuchungen weisen für Instagram eine Reichweite von in Deutschland aus. In der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren hat Instagram Facebook als beliebteste Social-Media-Plattform bereits zu Beginn des Jahrzehnts abgelöst. Aber: Die monatliche Nutzungsdauer liegt weiterhin bei „nur“ 8,5 Stunden und verdankt sich, besonders bei den jungen Nutzer:innen, zu erheblichen Teilen Kurzvideos (Reels) und den Direktnachrichten.
Als digitales Schaufenster von Initiativen und Organisationen eignet sich Instagram daher vor allem als Ergänzung zu einem plattformunabhängigen Angebot. Der Instagram-Algorithmus verstärkt – wie auch der von YouTube und TikTok – vor allem solche Kanäle, die monothematisch senden. Kirchgemeinden und Organisationen, die einfach nur ein Bild ihres häufig bunten Engagements zeichnen wollen, werden darum strukturell benachteiligt. Erfolgreicher sind Kanäle, die sich auf ein Thema, ein Bildprogramm oder eine:n Influencer:in konzentrieren. Kanäle, die ihr inhaltliches Angebot diversifizieren, werden von den Algorithmen regelmäßig abgestraft.
TikTok, YouTube, Twitch: Fernsehen für die Jugend
Innerhalb der Generation Z reüssiert von den multi interest Plattformen vor allem TikTok. TikTok bietet einer beeindruckenden Vielfalt von unterschiedlichen Communities und Neigungsgruppen eine Heimstatt und der Algorithmus der App ist besonders gut darin, Menschen in diese Nischen hineinzuführen. (Seit einigen Monaten erprobt TikTok, nicht zuletzt wegen der neueren EU-Gesetzgebung, auch einen social graph.)
Ein großer Teil des (anfänglichen) Erfolgs von TikTok verdankte sich den im Vergleich zu anderen Videoplattformen hervorragenden Werkzeugen für die Videobearbeitung, die zugleich einfach zu handhaben und für viele Zwecke geeignet sind. Aus diesem Grund wurde und wird TikTok trotz aller Bedenken auch in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen (und sogar Kindern) immer wieder eingesetzt. Alternativen stehen allerdings zur Verfügung.
Das gilt prinzipiell auch für das Hosting von längeren Videos im Netz. Trotzdem greifen die meisten Projekte und Produzent:innen weiterhin auf den Marktführer YouTube von Google (Alphabet) zurück. YouTube ist auch die größte Suchmaschine der Welt für Bewegtbild: Wer gefunden werden will oder die (verschwindend kleine) Chance aufs Viralgehen nicht verpassen will, kommt an YouTube weiterhin nicht vorbei. Die Generationen Z und Y nutzen neben diesen großen Video-Plattformen auch weitere Apps, um ihrer Lust an Bewegtbild nachzugehen, z.B. Twitch und Facebook Live für das Live-Streaming vor allem von Gaming-Content.
Kommentarspalten, Foren, Direktnachrichten: Die heimlichen Superstars
Prinzipiell können Nutzer:innen auf YouTube (sowie auch auf Spotify, um ein Beispiel aus dem Bereich Audio zu nennen) per Kommentar mit den Content-Anbietern in Kontakt treten. In den YouTube-Kommentarspalten entspannen sich, ähnlich wie in den Chats von Live-Streaming-Angeboten, immer wieder intensive digitale Gespräche. Solche intensiven Gespräche entfalten sich derzeit vor allem in den direct messaging-Funktionen von etablierten Plattformen wie Instagram. Laut Instagram-Chef Adam Mosseri ist der klassische Insta-Feed nur noch der dritt-, vielleicht viertwichtigste Ort auf der Plattform. Insbesondere junge User:innen verbringen ihre Zeit vor allem in den DMs und in den Insta-Stories.
Ganz nach Interessengebieten und Soziotopen orientiert treten digitale Communities weiterhin auch in Facebook-Gruppen oder (relativ neu) auf Discord oder im Umfeld von Substack-Newslettern zusammen. Bereits bestehende christliche Online-Gemeinden nutzen verschiedene Werkzeuge für das Community-Management und vor allem Zoom für ihre Treffen und Gottesdienste. Nicht zuletzt bieten Messenger-Apps inzwischen vielfältige Möglichkeiten, sich dort als Gruppe zu vernetzen (wie uns Querdenker und Corona-Leugner in den vergangenen Jahren zur Genüge vorgeführt haben).
Mikroblogging: Bye bye Twitter/X
Ein Extrakapitel müsste sich an dieser Stelle Twitter/X, Mastodon und Twitter-Klonen und Ersatzprodukten (Bluesky, Threads) widmen. Weil die Zahl der use cases für christliche Medienproduzent:innen und Nutzer:innen aber denkbar klein und derzeit besonders viel Bewegung im Markt ist, sourcen wir das Thema Microblogging an dieser Stelle in einen eigenen Beitrag aus.
Brauchts des alles? Nein, aber …
Wer mit einer konkreten Gruppe von Menschen arbeitet, z.B. einem Senioren-Kreis oder einer Konfirmanden-Gruppe, kann um die großen Social-Media-Plattformen getrost einen Bogen machen. Eng-geknüpfte, häufig lokal oder regional organisierte Sozietäten bedürfen des Umweges über eine algorithmen-gesteuerte, kommerzielle Plattform in aller Regel nicht. Von den darüber hinaus bestehenden Datenschutz-Bedenken wollen wir hier vornehm schweigen.
Als geeignete Werkzeuge für das Community-Management stehen für diese use cases insbesondere Messenger-Apps zur Verfügung, die digitale Kommunikation untereinander ermöglichen, sowie eine Vielzahl von kostenlosen und Open Source-Anwendungen für gemeinsame Projektarbeit (z.B. Bild- und Videobearbeitung, Quests usw.). Wer 2023 noch eine Gemeinde-Gruppe, allzumal von Minderjährigen, auf Insta, TikTok & Co. lotst, muss das stichhaltig begründen können: Welche Plattformfunktionen sind so unverzichtbar, dass sie die bestehenden Nachteile auszugleichen vermögen? Warum nutze ich keine Alternative? Vielleicht sogar eine, die im Auftrag einer Kirche entwickelt wurde oder sich im besonderen Maße an deren Bedürfnissen orientiert?
Um Kontakt mit Studien-Gruppen, Akademie-Publikum, der Kirchgemeinde und ihrem Sozialraum oder ganz generell einem größeren Kreis von Interessent:innen zu halten, bieten sich insbesondere E-Mail-Verteiler und Newsletter an. Sie bieten alle technischen Möglichkeiten, um vermittels eines geschickten Storytellings Menschen miteinander und mit der Organisation im Kontakt zu halten. Sie können darüber hinaus datenschutzgerecht gestaltet und genutzt werden. Ingesamt bietet das digitale direct mailing auch 50 Jahre nach Erfindung der E-Mail immer noch ungenutzte Potentiale.
Auch periodische oder saisonale Verkündigungsformate (z.B. Video- und Audio-Andachten, Podcasts, Texte, Predigten, etc.) müssen nicht zwingend auf einer der großen Plattformen ausgespielt werden, um ihr anvisiertes Publikum zu gewinnen – und als Beifang noch weitere Hörer:innen oder Zuschauer:innen, denen die Inhalte weitergeleitet werden. Für das Hosting von Audio- und Video-Inhalten stehen neben YouTube und Spotify auch Anbieter zur Verfügung, die datenschutzsensibel arbeiten und die Inhalte nicht auf ihren Plattformen einschließen.
Wer die (hoffentlich zahlreichen) digitalen Angebote seiner Organisation oder Kirchgemeinde bündeln will, sollte auch im Jahr 2023 Zeit und Kraft vor allem in die eigene Website investieren. Während kirchliche Arbeitsstellen und Werke sich in den vergangenen Jahren deutlich besser aufgestellt haben, zeigen Stichproben immer wieder, wie desolat Websites von Kirchgemeinden nach wie vor gestaltet sind. Eine große Zahl von Gemeinde-Websites ist nicht auf die mobile Nutzung via Smartphone hin optimiert, die Nutzer:innen-Steuerung ist mangelhaft und die Suchmaschinenoptimierung mindestens ausbaufähig.
Es ist erstaunlich, wie unkoordiniert und weitgehend erfolglos die Kirchen an einer flächendeckenden Verbesserung dieses Zustandes arbeiten. Ursächlich scheint hier weniger ein Mangel an Ressourcen oder Geldeinsatz zu sein, sondern die Unfähigkeit, sich auf Standards und Digitalisierungsziele zu einigen und zu konzentrieren. Einige Vorstöße in Richtung „digitaler Kirchtürme“ und kleinere Qualitätsoffensiven hat es in den vergangenen (Corona-)Jahren in einzelnen Bistümern und Landeskirchen dennoch gegeben. Es stellt sich die Frage, wie man Erfahrungen und Kompetenzen, die auf diesem Weg gewonnen wurden, nun überregional für den Gemeindeeinsatz nutzen kann. Kirchliche Fortbildungsangebote für Ehren- und Hauptamtliche, wie z.B. kirchendigital.de, werden offenbar trotz erheblichen Ressourcenaufwands nur in geringem Umfang angenommen.
Vom Feeling her ein ungutes Gefühl
In Umkehrung des alten Andreas-Möller-Zitats („Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl“) schauen Akteur:innen der digitalen Zivilgesellschaft und der Digitalwirtschaft sowie viele Nutzer:innen derzeit mit Sorgen auf die großen Social-Media-Plattformen. Die Übernahme und anschließende Zertrümmerung von Twitter durch Elon Musk gilt nicht wenigen als Menetekel für den Untergang von Social Media. Dienen die Dynamiken und die Ökonomie der Plattformen wirklich uns Menschen und unserem Sozialleben? („Social media ist doomed to die“, Ellis Hamburger, The Verge)
Zwar steigt die Zeit, die wir alle mit der Nutzung digitaler Medien und Werkzeuge verbringen, weiterhin an, aber das Nutzungsverhalten differenziert sich weiter aus. Auch jenseits von digital detox finden viele Menschen keinen Anschluss mehr zum Geschehen auf den großen Plattformen. Einige weichen auf Nischenangebote aus, andere verabschieden sich ganz. Wir halten digital vermittelt Kontakt mit Freunden und Familie, mit Kolleg:innen und Glaubensgeschwistern – aber das zunehmend häufiger jenseits der durch Werbung, Algorithmen und Plattforminteressen geprägten großen Plattformen.
Das Schicksal von Twitter und der Aufstieg von TikTok führen vor Augen, dass auch die großen Social-Media-Plattformen, die unser Leben in der Digitalität seit Mitte der 2000er Jahre maßgeblich geprägt haben, sterben und durch neue Angebote ersetzt werden können. Vielleicht wird man den Anfang des 21. Jahrhunderts tatsächlich als das Zeitalter des Web 2.0, des social web, erinnern, weil wir künftig andere Formen des digitalen Zusammenlebens priorisieren werden.
Wandel, Verfall und neue Trends werden jedenfalls auch in der eigentlich sehr optimistischen Techbranche gegenwärtig eher skeptisch aufgenommen: Zu viele Hypes haben sich in den vergangenen fünf Jahren als reine Chimären herausgestellt. Die großen Digitalunternehmen haben in den vergangenen Monaten viele tausende Mitarbeiter:innen entlassen. Wollen wir wirklich als digitale Avatare in einer Art Metaversum leben? Wollen wir statt in der Wikipedia und auf Google-Suche unsere Informationen und Nachrichten wirklich von einer KI zusammengestellt konsumieren? Tut uns Social Media gut – und wenn ja, wie viel davon? Wie social ist das Abhängen auf TikTok, Insta und YouTube tatsächlich?
Für digitale Akteur:innen steht daher die Notwendigkeit, plattformunabhängige Angebote zu schaffen, deutlicher vor Augen als noch zu Beginn des Jahrzehnts, als man Facebook & Co. für unsterblich hielt. Die großen Social-Media-Plattformen werden uns sicher noch einige Jahre erhalten bleiben, aber lohnt sich der Einsatz von Ressourcen für die Content-Produktion auf ihnen wirklich nachhaltig? Wer heute digitale Kampagnen und Angebote produziert, verfolgt daher mindestens einen Multi-Plattform-Ansatz.
Für christliche Akteur:innen stellt sich die Frage umso drastischer, ob ein Engagement auf solchen Plattformen weiterhin angeraten ist, die keineswegs faire Marktplätze für Meinungen, Nachrichten und das bürgerschaftliche Zusammenleben sind. Um Wert und Risiko eines Engagements auf den großen Social-Media-Plattformen besser bewerten zu können, muss das Wissen um die Funktionalität der Plattformen unter Christ:innen vertieft und verbreitet werden. Auch christliche Nutzer:innen schließen viel zu schnell von der eigenen Nutzung auf die Allgemeinheit und schreiben intentionale Effekte der Programmierung dem Zufall oder eigenen Präferenzen zu.
Wer sicherer auf und mit den gegenwärtigen Social-Media-Plattformen leben will, muss besser Bescheid wissen. Damit ist eine bleibende Aufgabe für die pädagogische Arbeit sowohl mit Kindern und Jugendlichen als auch mit Erwachsenen im Raum der Kirche umrissen. Nicht zuletzt müssen plattformkritischen Diskurse auch innerhalb der christlichen Digitalangebote selbst geführt werden.
Mehr:
- Twitter/X geht den Bach runter, adäquate Alternativen sind rar gesät. Wie können kirchliche Akteur:innen und christliche Nutzer:innen auf die Veränderungen reagieren? Was taugen Bluesky, Threads und Mastodon? Im zweiten Teil des Social-Media-Updates befasst sich Eule-Redakteur Philipp Greifenstein mit den Mikroblogging-Plattformen.
- Wie können Christ:innen auf Instagram leben? Darüber diskutierten wir live mit der Bloggerin Kira Beer und Eule-Abonnent:innen im Herbst 2022. Für eine ehrliche Debatte über Social-Media-Nutzung in der Kirche: „Instagram: Zwischen „Reel me in“ und Bubble-Gefängnis“
- Die Kirche im Netz sitzt weiterhin Missverständnissen auf, die ihren Erfolg behindern. Zeit, sie auszuräumen: „5 Missverständnisse der Kirche im Netz“
- Eine midi-Studie über christliche Influencer:innen auf Instagram zeigt, worin sich digitale und analoge Kirche ähnlich sind – und welche Herausforderungen für die Kirche im Netz bestehen: „Sinnfluencer-Studie: Followerinnen sind schon Christinnen“
- alle Eule-Beiträge des Themenschwerpunkts #digitaleKirche
