Ein Plädoyer für gerechte Ordnungen und Verhältnismäßigkeit
Wie begegnet das neue Friedenswort der Deutschen Bischofskonferenz „Friede diesem Haus“ den aktuellen Herausforderungen? Und welche Rolle kommt der Religion überhaupt noch zu?
Mit ihrem aktuellen Friedenswort „Friede diesem Haus“ schließt die katholische Deutsche Bischofskonferenz an eine reichhaltige Tradition an. Einige der Dokumente der katholischen Kirche zur Friedensethik gehören zu den stärksten Texten einer – wenn man so sagen darf – religiös motivierten und inspirierten politischen Ethik. Auf weltkirchlicher Ebene hat Papst Johannes XXIII. 1963 mit der Enzyklika „Pacem in terris“ einen klaren Blick auf die Herausforderungen einer gerechten Weltordnung entwickelt und die Weichen zu einer vorbehaltlosen Anerkennung der liberalen Menschenrechte durch die Kirche gestellt.
Die Deutsche Bischofskonferenz konnte an historisch markanten Stellen ebenso ausgewogene wie weiterführende „Friedensworte“ veröffentlichen, vor allem 1983 „Gerechtigkeit schafft Frieden“ zur Situation des Kalten Krieges und zur Frage der nuklearen Aufrüstung sowie 1990 „Gerechter Friede“ in einer ambivalenten Phase der Entwicklung Europas, die einerseits nach dem Ende der Blockkonfrontation eine friedlichere Welt erhoffen ließ, andererseits mit den Kriegen im zerfallenden Jugoslawien von brutalen Gewaltausbrüchen gekennzeichnet war.
Neben vielen anderen Gesichtspunkten stand dabei ein Gedanke besonders im Vordergrund: Das Mittel gegen militärische Gewalteskalation ist die Implementierung einer gerechten Ordnung. Für Johannes XXIII. waren eine internationale Politik der Menschenrechte und der moderne Verfassungsstaat (der, das darf man nicht vergessen, erst zwei Jahre später auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil ausdrücklich anerkannt wurde) die Grundlagen einer gerechten Ordnung.
Auch in den Dokumenten der Deutschen Bischofskonferenz verschob sich die Blickrichtung von der Legitimation militärischer Gewalt zur Vermeidung militärischer Gewalt durch eine gerechte Friedensordnung. Diese Verknüpfung von Kriterien legitimer militärischer Gewaltanwendung, die auf die Tradition der Lehre vom gerechten Krieg verweisen, mit der Notwendigkeit einer gerechten ökonomischen und politischen (Welt-)Ordnung, die die Pointe der Idee des gerechten Friedens ist, ist die systematische Pointe der katholischen Friedensethik der Gegenwart. Sie prägt auch das nun veröffentlichte Dokument der katholischen Bischöfe „Friede diesem Haus“.
Drei Herausforderungen der Gegenwart
Das Dokument soll kein Kompendium der Friedensethik sein, sondern die in den oben genannten Texten entwickelte Tradition des gerechten Friedens fortschreiben. Diese ist ihrerseits eine Weiterentwicklung der Lehre vom gerechten Krieg, die – heute präziser und besser gefasst als Kriteriologie legitimer militärischer Gewaltanwendung – Teil der Idee des gerechten Friedens (geblieben) ist.
Auch im aktuellen Friedenswort wird an mehreren Stellen auf diese Kriteriologie bzw. auf einzelne Kriterien Bezug genommen (etwa Nr. 62, 197). Eine Notwendigkeit der Weiterentwicklung wird nicht aus den aktuell im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung stehenden Kriegen begründet, sondern aus drei Herausforderungen, die als Kennzeichen der Gegenwart identifiziert werden: (a) die zunehmende und sich gewissermaßen ausdifferenzierende Gewalt, (b) die Erosion der internationalen Ordnung, die auf dem internationalen Recht und (wirksam agierenden) internationalen Organisationen beruht, (c) die ambivalente Bedeutung nationaler, ethnischer, kultureller und religiöser Identitäten und entsprechender Identitätspolitiken.
Zentrale Probleme: Verhältnismäßigkeit und gerechte Ordnung
Die Bischöfe rufen in ihrem aktuellen Friedenswort die Legitimitätskriterien einer gerechten militärischen Gewaltanwendung (die sie analog auch auf andere, etwa polizeiliche Gewaltanwendung beziehen) in Erinnerung. Demnach ist Gewalt …
„… grundsätzlich nur in der Form von Gegengewalt rechtfertigbar […], d.h. in Situationen der Notwehr, Nothilfe oder zum Schutz wehrloser Opfer schwerster und systematischer Menschenrechtsverletzungen. In solchen Fällen kann der Einsatz von Gewalt als ultima ratio gerechtfertigt sein, insofern sie auf der Grundlage internationaler rechtlicher Bestimmungen und Verfahren angewandt wird, verhältnismäßig und zielführend ist und die Regelungen des ius in bello achtet.“ (Nr. 62)
Dieser knapp und konzentriert gehaltene Rekurs auf die Lehre vom gerechten Krieg nennt die Kriterien des ius ad bellum, des Rechts zur Kriegsführung: In den Formeln der Tradition zuerst causa iusta (der gerechte Grund) dann ultima ratio (das letztmögliche Mittel), auctoritas legitima (die legitime Autorität), proportionalitas (Verhältnismäßigkeit) und schließlich – mit der knappen Andeutung „zielführend“ – recta intentio (die gerechte Absicht) bzw. finis causa (die Zweckursache).
Außerdem wird – ein wenig inkohärent zum Vorausgegangenen nicht im Einzelnen aufzählend, sondern auf den Oberbegriff verweisend – auf „die Regelungen des ius in bello“ (das Recht im Krieg, Nr. 62) verwiesen. Zu diesen wird meist neben der (im Anwendungsdetail oft schwierigen) Unterscheidung von militärischen und zivilen Personen die Verhältnismäßigkeit (also die oben als Kriterium des ius ad bellum genannte proportionalitas) gezählt.
Warum diese sowohl als Kriterium des ius ad bellum als auch des ius in bello erscheint, hat einen besonderen, gleich zu erörternden Grund, der auch in aktuellen Konflikten von großer Bedeutung ist. Im Horizont der gegenwärtigen Herausforderungen jedenfalls lässt das Friedenswort der deutschen Bischöfe zwei Gesichtspunkte scharf hervortreten: die Verhältnismäßigkeit der Mittel und die Notwendigkeit einer gerechten Ordnung.
Neues Friedenswort der DBK: „Friede diesem Haus“ (DBK)
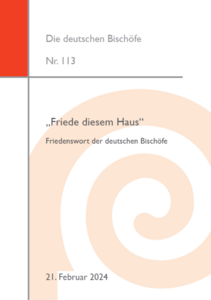 Im Februar 2024 hat die römisch-katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) ihr neues Friedenswort „Friede diesem Haus“ vorgestellt. Der 175-seitige Text kann als PDF hier heruntergeladen werden. Auf der Website der DBK findet sich auch eine kürzere Zusammenfassung (PDF). In „Friede diesem Haus“ werden grundsätzliche Gedanken zu Krieg und Frieden entfaltet. Das Dokument verdankt sich dem Veränderungsdruck auf die christliche Friedensethik angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und beginnt mit den Schlagworten „Zeitenwende“ und „Schöpfungsverantwortung“.
Im Februar 2024 hat die römisch-katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) ihr neues Friedenswort „Friede diesem Haus“ vorgestellt. Der 175-seitige Text kann als PDF hier heruntergeladen werden. Auf der Website der DBK findet sich auch eine kürzere Zusammenfassung (PDF). In „Friede diesem Haus“ werden grundsätzliche Gedanken zu Krieg und Frieden entfaltet. Das Dokument verdankt sich dem Veränderungsdruck auf die christliche Friedensethik angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und beginnt mit den Schlagworten „Zeitenwende“ und „Schöpfungsverantwortung“.
Selbstverteidigungsrecht und Verhältnismäßigkeit
Zur Abwägung zwischen Selbstverteidigungsrecht und Verhältnismäßigkeit „wiederholen“ die Bischöfe in „Übereinstimmung mit der Friedensethik der Kirche“ und im „Wissen um die Eskalationsgefahr, die auch der legitimen Selbstverteidigung innewohnt“, „Bedingungen […], unter denen das Recht auf Selbstverteidigung ausgeübt wird“:
„Niemals stellt das Recht auf Selbstverteidigung einen Freibrief für eine Kriegsführung dar, die gegen die Regeln des Kriegsvölkerrechts verstößt, insbesondere gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Es bietet auch keinen Rechtsgrund für Rache und Vergeltung, schon gar nicht, wenn sie die Zivilbevölkerung treffen. Gerechte Verteidigung muss Wege zu Verständigung und Frieden offenhalten oder öffnen, sie darf keinen bewusst verschließen. Das Ziel jedes Militäreinsatzes, sofern er aus christlicher Sicht legitim sein soll, ist nicht der Sieg, sondern ein gerechter Friede. […]
Kein Einsatz militärischer Gewalt darf deswegen die Bedingungen eines künftigen Friedens zerstören, vor allem nicht das Minimum an gegenseitigem Vertrauen, ohne das es weder aussichtsreiche Friedensverhandlungen noch einen tragfähigen Friedensschluss geben kann.“ (Nr. 31)
Die Verhältnismäßigkeit der Mittel wird derzeit bekanntlich vor allem im Hinblick auf den Krieg Israels gegen die Hamas breit erörtert. Zunächst stellt sich die Frage, ob es grundsätzlich verhältnismäßig ist, seitens des Staates Israel mit militärischen Mitteln auf den Terrorangriff des 7. Oktober 2023 zu reagieren.
Auch wenn man die in völkerrechtlicher Hinsicht besondere Situation des Verhältnisses von Israel und Palästina bzw. des Gazagebiets und Israels und die kompliziert zu fassende Rolle der Hamas berücksichtigt, kann der Einsatz des israelischen Militärs grundsätzlich als Akt der Selbstverteidigung legitimiert werden. Es handelt sich und eine Form der Gegenwehr gegen einen brutalen, progromartigen Angriff, von dem vor allem Zivilpersonen betroffen waren – und zwar nicht als „Kollateralschaden“, sondern unmittelbar intendiert. Das Ziel der Befreiung von Geiseln und die Bekämpfung der Hamas als angreifende oder den Angriff koordinierende Organisation sind einen Krieg rechtfertigende Ziele – mit der bleibenden Unsicherheit freilich, ob und inwiefern dieser Krieg tatsächlich der Erreichung dieser Ziele dient.
Die ultima ratio ist im Horizont des Selbstverteidigungsrechts ohnedies ein umstrittenes Kriterium, worauf etwa Michael Walzer hingewiesen hat: Schränkt angesichts eines akuten kriegerischen Angriffs von außen das Kriterium der ultima ratio tatsächlich das Selbstverteidigungsrecht ein, und sei es nur retardierend? Sofern man nicht auf einem strikt pazifistischen Standpunkt steht oder davon ausgeht, dass der Staat Israel durch seine Politik oder sogar schlicht durch seine Existenz immer schon als Aggressor zu betrachten ist, wird man ein Selbstverteidigungsrecht Israels nach dem 7. Oktober sowie angesichts fortgesetzter Angriffe durch die Hamas und immer noch festgehaltener Geiseln kaum bestreiten können.
Wechselwirkungen: Die Verhältnismäßigkeit des Krieges
Schwieriger ist die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Krieg gegen die Hamas. Tatsächlich wird die Verhältnismäßigkeit ja vor allem im Hinblick auf die Art und Weise, wie Israel in Gaza den Krieg gegen die Hamas führt, kontrovers erörtert, und zwar auch von Akteuren, die das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bestreiten und den Krieg gegen die Hamas für legitim halten. Die Auswirkungen dieses Krieges auf die Zivilbevölkerung in Gaza seien derart dramatisch, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt sei. Dass es hier nicht um das ius ad bellum, sondern um das ius in bello geht, ist nicht trivial, sondern zeigt, dass bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit zwei Gesichtspunkte unterschieden werden müssen.
Einerseits kann die Verhältnismäßigkeit der Anwendung der Mittel in einem Krieg (ius in bello) auf die Legitimität des Krieges (ius ad bellum) durchschlagen. Es ist also denkbar, dass auch in einem grundsätzlich legitimen Krieg gegen einen Aggressor die in diesem Krieg eingesetzten Mittel – etwa Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung – derartig massiv sind, dass sie nicht nur selbst als nicht legitim gelten können, sondern auch die Legitimität des Krieges selbst in Frage stellen.
Andererseits ist es für die Bewertung der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel relevant, ob der Einsatz von militärischer Gewalt grundsätzlich verhältnismäßig ist und ob es sich an und für sich um einen legitimen Einsatz militärischer Gewalt handelt. Die Bomben der Alliierten auf Hamburg und München sind eben nicht einfachhin gleich zu bewerten wie die Bomben der Wehrmacht auf Coventry und Rotterdam. Die Lage in Gaza ist eine humanitäre Katastrophe; die Situation der Zivilbevölkerung muss unbedingt verbessert werden. Zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Kriegsführung Israels ist aber nicht nur diese Situation in Gaza relevant, sondern auch die grundsätzliche Legitimität des Krieges als Mittel der Verteidigung gegen die (fortgesetzte) Gewalt gegen Israel von Seiten der Hamas und das (andauernde) Festhalten israelischer Geiseln durch die Hamas.
Damit kann die Frage der Verhältnismäßigkeit des Krieges Israels gegen die Hamas allerdings nicht „gelöst“ werden, sondern sie verweist auf die Einschätzung der Gesamtsituation des Nahostkonflikts. Wer den 7. Oktober nicht als pogromartigen Angriff oder Terrorakt, sondern als bewaffneten Widerstand gegen den Aggressor Israel versteht (und damit als Selbstverteidigung legitimiert), wird auch den Krieg Israels gegen die Hamas nicht als legitime Selbstverteidigung interpretieren können. Wer Israel insgesamt als illegitimen Vorstoß des Judentums oder des Westens in den Nahen Osten betrachtet, wird nicht von einer legitimen Gewaltanwendung Israels ausgehen. Mit anderen Worten: Die Frage der Verhältnismäßigkeit des Krieges in Gaza kann letztlich nur von einem Standpunkt zur Frage des Existenzrechtes Israels aus beantwortet werden.
Gerechte Friedensordnung und Vorrang des Rechts
Damit kommt ein zweiter Gesichtspunkt ins Spiel, der allerdings weit weniger prominent öffentlich debattiert wird: Die Frage der legitima auctoritas konnte in der christlichen Tradition problemlos mit dem religiösen Wahrheitsanspruch beantwortet werden. Solange Religion und Politik als Einheit oder zumindest verknüpft gedacht wurden, konnte jenes politische Gemeinwesen, das seine politische Gewalt an die wahre Religion knüpfte, einen Krieg legitimieren.
Das Verhältnis zwischen Politik und Religion beruhte dabei auf einem reziproken Interesse: Die Kirche beanspruchte politische Gewalt, weil sie eine religiöse (Wahrheits-)Grundlage für konstitutiv für ein legitimes politisches Gemeinwesen hielt; dieses wiederum bedurfte genau einer solchen Legitimationsgrundlage. Damit aber wurden religiöse Motive gewissermaßen „automatisch“ – über das Kriterium der legitimen politischen Autorität – auch Teil der Begründung von militärischer Gewalt.
Erst mit dem Zweiten Vatikanum löste sich die katholische Kirche endgültig von dieser Vorstellung – und erst damit konnte die Weiterentwicklung der Lehre vom gerechten Krieg zur Idee des gerechten Friedens vollzogen werden. In allen Schichten der Entwicklung der Friedensethik (Spätantike, Scholastik, Spätscholastik, 19./20. Jahrhundert) spielte die Frage der auctoritas legitima eine zentrale Rolle, also letztlich die Frage nach einer legitimierten politischen Gewalt als eine der Voraussetzungen für eine legitime militärische Gewaltanwendung. Dieser zentrale Aspekt der politischen Ethik gehört in Katholizismus und katholischer Kirche traditionell zum Gegenstandsbereich der „Staatslehre“, die sich – in einer sehr groben Gegenüberstellung – von einer strikten Ablehnung moderner, säkularer Rechtsstaatlichkeit im (späten) 19. Jahrhundert zu einer bedingungslosen Anerkennung des freiheitlichen und demokratischen Verfassungsstaates samt den liberalen Menschenrechten mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wandelte.
Mit diesem Schritt bekannte sich die katholische Kirche zum Vorrang der säkularen Rechtsordnung, die ihre Legitimation (und Limitation) aus der allseitigen Zustimmungsfähigkeit der Rechtssubjekte schöpft. Die Religion dagegen tritt zurück und ist nur noch eine partikulare Idee des guten Lebens, die im Rahmen der Religionsfreiheit mehr oder weniger weite Freiheitsspielräume genießt. Dieser – schon in den Arbeiten der Spätscholastik angelegte – Vorrang des (allseitig zustimmungsfähigen) Rechts vor (unterschiedlichen) weltanschaulichen Wahrheitsansprüchen ist konstitutiv für die Idee des gerechten Friedens, die ja gerade vorsieht, dass eine stabile Rechtsordnung gewissermaßen das Koordinatensystem für die Koexistenz unterschiedlicher Überzeugungen und Interessen bildet.
Die Bischofskonferenz hält, wie oben bereits erwähnt, als eine der großen Herausforderungen der Gegenwart fest, dass das System einer internationalen Rechtsordnung, das auf einem globalen Menschenrechtsethos und mehr oder weniger effektiven internationalen Organisationen errichtet werden sollte, erodiert und schon obsolet erscheint, bevor es wirklich wirksam werden konnte. Auch die russische Aggression gegen die Ukraine interpretieren die Bischöfe als fatalen vorläufigen …
„… Endpunkt eines Prozesses, in dem sich der fortschreitende Verfall der gegen Ende des Kalten Krieges entstandenen Weltordnung zunehmend abzeichnete. Spätestens seit den Terroranschlägen des 11. September 2001 auf New York und Washington trat an die Stelle der vom Westen propagierten liberalen, regelgeleiteten und institutionenbasierten internationalen Politik mit der Aussicht auf eine Friedensdividende ein allmählicher Rückfall in traditionelle Macht-, Geo- und Realpolitik.
Mit ihr einher ging eine zunehmende Blockade internationaler Institutionen und ein Aufkommen von Identitätspolitik. Diese erweist sich dabei als treibende Kraft eines politischen Denkens, das streng in nationalen Kategorien verhaftet ist und so kooperationshemmend zu wirken vermag.“ (Nr. 82)
Damit wird aber deutlich, dass mit dem Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine auch ein Anschlag auf die internationale Rechtsordnung verbunden ist, mit dem das Recht des Stärkeren durchgesetzt werden soll. „Solche Perversionen des Rechts lassen sich nur verhindern durch aufrechte und mutige Verteidigerinnen und Verteidiger des Rechts.“ (Nr. 64)
Mit einer völlig anderen Haltung als Papst Franziskus und seinen Interventionen über das Hissen der „weißen Fahne“ angesichts der Bedrohung durch die Übermacht eines Aggressors bleiben die deutschen Bischöfe beim Vorrang des Rechts als Grundlage eines gerechten Friedens:
„Rechtsbefolgung und Rechtsdurchsetzung basieren auf einem Rechtsethos, ohne das kein Rechtsstaat entstehen und existieren kann. Dieses Ethos deckt sich mit der Haltung aktiver Gewaltfreiheit insofern, als jedes Recht, das in einem echten Gerechtigkeitssinn verankert ist, Gewalt verhindern oder mindern will.
Umstritten ist allerdings, ob es mit dieser Haltung vereinbar ist, Gewalt auszuüben, um Gewalt zu bekämpfen. Wir bejahen das, weil nach unserer Überzeugung die Haltung der Gewaltfreiheit nicht zwingend nach einem radikalen und absoluten Gewaltverzicht verlangt, und weil der Staat, um seine Bürgerschaft vor Gewalt schützen zu können, in der Lage sein muss, notfalls Gewaltmittel einzusetzen.“ (Nr. 64)
Und die Rolle der Religion?
Aber auch die Religion spielt für die von den Bischöfen genannten Identitätspolitiken – häufig im Zusammenspiel mit kulturellen und nationalen Identitäten – nach wie vor eine Rolle. Für die Bestätigung der Legitimität des Krieges der Russischen Föderation etwa trifft das ebenso zu wie für verschiedene Facetten des Nahost-Konflikts.
Auch wenn „Angehörige der Hochreligionen“ gerne dazu neigen, „jede substanzielle Beziehung zwischen Religion und Gewalt zu bestreiten“, helfe „diese eilfertige Apologetik […] nicht weiter, da sie das Problem unzulässig vereinfacht“ (Nr. 65). Jedenfalls greife es „zu kurz, den unter Umständen gewaltfördernden Beitrag der Religionen nur als Folge einer politischen Instrumentalisierung zu begreifen“. Vielmehr strebten Religionen „– mit welchem Ziel auch immer – selbst nach politischem und gesellschaftlichem Einfluss“. Sie „können sich zu politischen Erwartungen und Zumutungen, die an sie herangetragen werden, selbst verhalten und eigenständige Entscheidungen treffen.“ (Nr. 67) „Auf keinen Fall sollten Religionen in Konflikten zusätzlich Öl ins Feuer gießen und Gewalt verklären oder gar heiligen.“ (Nr. 68)
Genau dies dürfte aber in den gegenwärtigen Konflikten der Fall sein, deren religiöse Implikationen hier aber nicht weiter erörtert werden können. Sie müssen aber jedenfalls – in ihrer konfliktverschärfenden wie auch in ihrer möglichen friedensstiftenden Dimension – berücksichtigt werden.
Die Überlegungen des Beitrags gehen u.a. zurück auf den aktuellen Forschungsschwerpunkt „Religionen zwischen Krieg und Frieden“, an dem außer Christian Spieß auch Regina Elsner (Münster), Oliver Hidalgo (Passau), Jochen Töpfer (Magdeburg), Katja Winkler (Linz) und Alexander Yendell (Leipzig) beteiligt sind. Einige Ergebnisse wurden im Journal Ethik und Gesellschaft publiziert und auf einem Symposium „Religionen als Friedensstifter – Religionen als Brandstifter“ diskutiert.
Mehr:
- Zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die gesamte Ukraine suchen die Kirchen nach ihrem Platz in der „Zeitenwende“. Eule-Redakteur Philipp Greifenstein schreibt über den „Krieg um das christliche Abendland“.
- Kritische Anmerkungen aus Perspektive der Friedenstheologie zum Friedenswort der Deutschen Bischofskonferenz „Frieden diesem Haus“ formuliert apl. Prof. Thomas Nauerth: „Diese Welt braucht keine Religion, die zu allem Ja und Amen sagt“
- Wie steht es um die Ukraine, ihre Menschen und die Geflüchteten? Welche Rolle spielen die Kirchen im Konflikt? Darüber sprach Eule-Redakteur Philipp Greifenstein im Dezember 2023 erneut mit der Ostkirchen- und Osteuropaexpertin Regina Elsner im „Eule-Podcast“. Die Positionierung von Papst Franziskus in den aktuellen Kriegen war auch Thema im „Eule-Podcast“-Monatsrückblick Dezember / Jahresrückblick 2023.
- Alle Eule-Beiträge zum Ukraine-Krieg und zum Nahost-Konflikt.
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.
