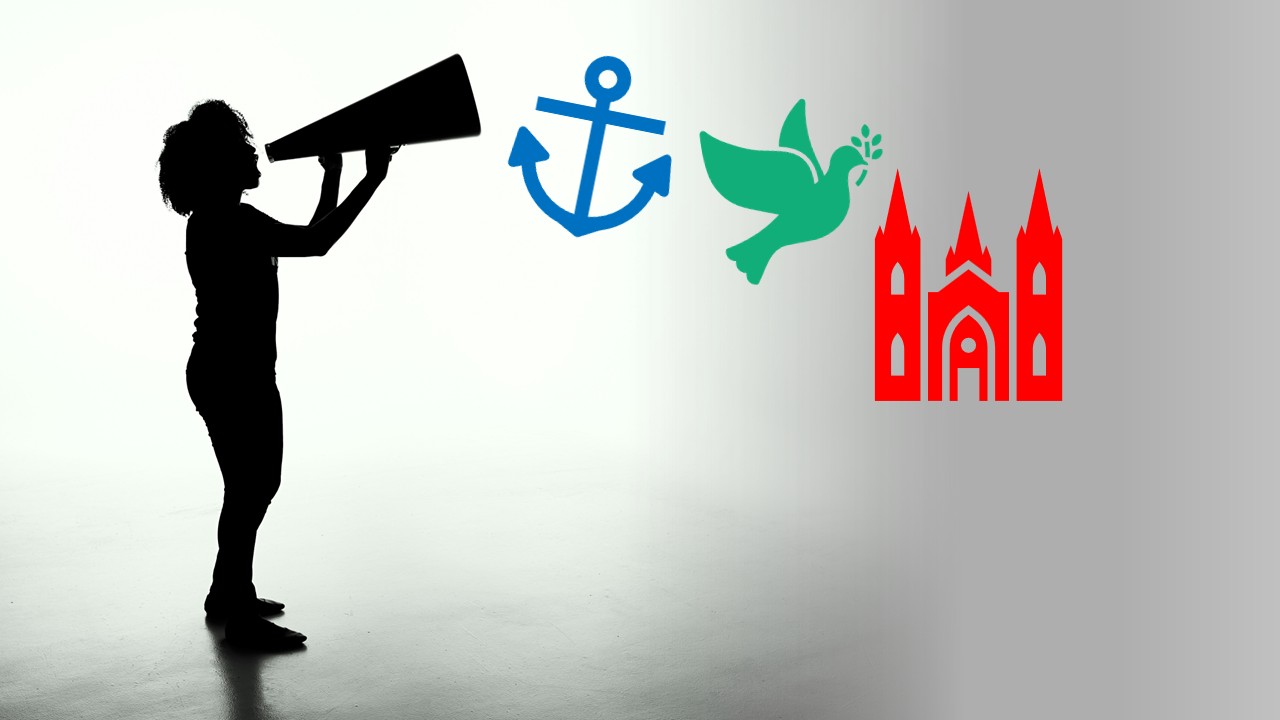
Die Zukunft der Flüstertüte
Wohin steuert die evangelische Publizistik? Welche Wege führen aus Relevanz-, Reichweiten- und Glaubwürdigkeitskrise? Wie verändert sich das Selbstverständnis der evangelischen Kirchenpresse?
Wo steht die evangelische Publizistik heute? Vom 28. Februar bis 1. März 2024 hat in der Evangelischen Akademie Tutzing unter dem Titel „Evangelische Publizistik – wohin?“ eine Tagung stattgefunden, die „Auftrag, Aufstellung und Zukunft des kirchlichen Journalismus“ in den Mittelpunkt stellte. Veranstaltet wurde die Tagung von der Akademie Tutzing in Kooperation mit dem Magazin zeitzeichen, der Universität Greifswald und dem Evangelischen Medienverband in Deutschland (EMVD). Bereits im Vorfeld der Tagung erschien in der Evangelischen Verlagsanstalt ein Buch zur Tagung.
Ich habe als Podiumsteilnehmer an der Schlussrunde der Tagung teilgenommen und im Anschluss an die Tagung im Tagungsband der epd Dokumentation (23-24/24) meine Eindrücke geschildert. Auf dem Schlusspodium, das vom Chefredakteur der zeitzeichen, Reinhard Mawick, moderiert wurde, diskutierten außerdem Ariadne Klingbeil, die (im Frühjahr 2024) neue kaufmännische Geschäftsführerin des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP), und Roland Gertz, Direktor des Evangelischen Presseverbands für Bayern (EPV), der auf der Tagung bereits vom Umbau seines Medienhauses zum neuen „Campus Kommunikation“ der bayerischen Landeskirche berichtet hatte.
Mir erscheinen die in Tutzing aufgeworfenen Fragen und Antwortversuche heute ebenso aktuell wie vor einem Jahr – auch weil seither wenig unternommen wurde, um den problematisierten Krisen entgegenzutreten. Deshalb stellen wir hier in der Eule meinen epd Dokumentation-Beitrag zur Diskussion. Des besseren Verständnisses wegen wurde der Text an einigen Stellen gekürzt bzw. präzisiert. Außerdem wurde dem Text eine neue Einleitung vorangestellt.
Einleitung (Ein Jahr nach Tutzing)
Debatten über das eigene Selbstverständnis gehören konstitutiv zur evangelischen Publizistik. Evangelische Publizistik kann niemals in affirmativer Begleitung des kirchlichen Handelns aufgehen. Ihr ist als konfessionelle Signatur seit ihren Ursprüngen in der Medienrevolution der Reformation die Kritik der Institution mitgegeben, auf die sie sich bezieht und/oder von deren Traditionsbeständen und Überzeugungen aus sie auf die Gesellschaft blickt. Aus diesem kritischen Moment erwächst auch die Notwendigkeit zur selbstkritischen Beobachtung.
Erschwert wird die Praxis dieser Haltung, die man wohl vereinfachend mit dem aus dem Journalismus vertrauten Leitwert der Unabhängigkeit bezeichnen kann, dadurch, dass evangelische Publizistik maßgeblich von der Institution Kirche veranstaltet wird. Dieses Dilemma besteht seit den Ursprüngen der evangelischen Publizistik und wurde in den Gründungsjahren der Bundesrepublik als Lehre aus der erfolgten Gleich- oder Stummschaltung evangelischer Medien während des Nationalsozialismus dahingehend bearbeitet, dass sich die kirchliche evangelische Publizistik in Vereinsstrukturen neben der Amtskirche organisierte.
Zugleich gab es in der Bundesrepublik über viele Jahrzehnte hinweg eine vollständig kirchenunabhängige, in den nicht-kirchlichen Medien des Landes beheimatete und in zahlreichen Periodika und Diskussionsforen geübte Publizistik, die von evangelischen Akteur:innen, Theolog:innen, Journalist:innen, Denker:innen etc. betrieben wurde. Davon sind heute, wie von den Milieus, die diese Aktivitäten getragen haben, nur noch kleine Reste übrig.1
Durch Kooperationen, Zentralisierungen und Rationalisierungen der kirchlichen Medien werden die Möglichkeiten für relativ institutionenabständigen und kritischen Journalismus zunehmend kleiner. Wie bei der Schließung der Evangelischen Journalistenschule (ejs) auch einer nicht-kirchlichen Öffentlichkeit vorgeführt, fragen Verantwortliche der Kirchen in Synoden und Kirchenämtern auch bei ihren Medien zunehmend, welchen handfesten Nutzen für die Mitgliederbindung und -Gewinnung ihr (finanzielles) Engagement für die Publizistik hat.
Zugleich beharren nicht allein Journalist:innen darauf, dass die evangelische Publizistik einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet, der sich nicht in der Mitgliederkommunikation erschöpft. Der Chefredakteur des Evangelischen Pressedienstes (epd), Karsten Frerichs, fasst diesen Beitrag knapp zusammen: „Evangelische Kirche leistet mit den von ihr getragenen Medien einen gesellschaftsdiakonischen Beitrag zum gelingenden Zusammenleben, ja, zu nichts weniger als dem Schutz der Demokratie.“ Und der (inzwischen aus dem Amt geschiedene) Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, nennt die evangelische Publizistik „einen Beitrag der Kirche zur Gestaltung der Gesellschaft, und zwar zu einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft“.
Hierbei ist vor allem an die Sichtbarmachung und Problematisierung von sozialen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Themen und Fragen zu denken, die ohne den Zugriff der evangelischen (im weiteren Sinne: konfessionellen) Publizistik im gesellschaftlichen Diskurs der Gegenwart keine oder doch eine noch viel stärker marginalisierte Rolle spielen würden. An dieser Stelle hat auch die Mahnung des Gründervaters der evangelischen Publizistik nach dem 2. Weltkrieg, Robert Geisendörfer, weiterhin Gewicht, nach der die kirchliche Publizistik zur Aufgabe hat: „Fürsprache üben, Barmherzigkeit vermitteln und Stimme leihen für die Sprachlosen“.
In der epd Dokumentation zur Tagung zitiert Karsten Frerichs dazu ergänzend aus dem „Publizistischen Gesamtplan der Evangelischen Kirche“ von 1979, Teil des Auftrags sei, dafür zu sorgen, „daß planvoll unterdrückte und vernachlässigte Informationen und Meinungen im Interesse der Gerechtigkeit und Wahrheit veröffentlicht werden“. Ihren einzig sinnvollen Ausdruck findet diese Dimension gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme der evangelischen Publizistik durch eine Praxis des Journalismus.
Damit ist mehr als die äußere Form gemeint, „keine frommen Sprüche, sondern Journalismus zu produzieren“ (Geisendörfer). Selbst wenn durch einen solchen guten Journalismus en passant auch kirchliche Eigeninteressen mit-kommuniziert werden, muss die Trennlinie zur explizit kirchlichen Kommunikation gewahrt werden. epd-Chefredakteur Frerichs kündigte daher seinen „entschiedenen Widerspruch“ gegen eine Praxis an, in der „professionelle journalistische Standards nur imitiert werden sollen, um Öffentlichkeitsarbeit und Institutionenkommunikation unter dem Deckmantel des Journalismus zu betreiben“.
Was zunächst wie eine typische Abgrenzungsbemühung aus Gründen des Berufsethos erscheint, gewinnt unter dem Eindruck digitalisierter Kommunikation an Schärfe. Viele Kirchenmedien, kirchliche Medienschaffende und Influencer:innen bedienen sich in der Tat (pseudo-)journalistischer Formate. Das Problem reicht über die kirchliche Publizistik weit hinaus: Wir sind insbesondere auf Social-Media- und Streaming-Plattformen tagtäglich mit Branded Content, Native Advertising und einer Vielzahl von Formaten konfrontiert, die einstmals geachtete Grenzen im Interesse der Protagonist:innen und Produzent:innen überschreiten. Es stellt sich nicht zuletzt die Frage, ob wir als Medienkonsument:innen nicht längst das Gespür und die Kompetenz dafür verloren haben, wirklich unterscheiden zu können, was wir bei einem konkret vorliegenden publizistischen Produkt zu sehen bekommen: Journalismus oder PR?
Ein Sprachrohr – aber für wen?
Evangelische Publizistik ist heute im Vergleich zu vormaligen Jahrzehnten viel kleiner und schon organisatorisch häufiger unmittelbar auf die Institution Kirche bezogen. Im besten Fall betreiben Kirche (und Diakonie) ihr publizistisches Engagement im Sinne der Eröffnung eines Ermöglichungsraumes. Das Schwinden des völlig kirchenunabhängigen evangelischen (im weiteren Sinne: konfessionellen) Diskurses weist aber auf eine Bindung auf die Institution hin, die sich nicht allein in organisatorischen Fragen erschöpft. Ohne die Institution Kirche als Trägerin einer evangelischen Erzählgemeinschaft auch keine evangelische Publizistik. Die Frage, ob es ohne Kirche Glauben geben kann, entzweit Theolog:innen und Religionssoziolog:innen. Aus meiner ostdeutschen Perspektive jedoch kann ich sagen: Wo keine Kirche, da auch kein christlicher Diskurs.
Deshalb ist es legitim, nach der Funktion evangelischer Publizistik für die Kirche zu fragen. Sie kann, wie eingangs behauptet, nicht allein darin liegen, journalistisches Handwerkszeug für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung zu stellen, sondern besteht in der Sichtbarmachung des Austauschs der (evangelischen) Christen über ihren Glauben, die Formen, in denen er gelebt wird, und damit die Gestalt der Kirche und ihres Handelns.
Die doppelte Funktion der evangelischen Publizistik für die Kirche als Sichtbarwerdung der Kommunikation der Kirchenmitglieder und als Kommunikation der Kirchen mit den nicht-kirchlichen Öffentlichkeiten wird besonders dort prekär, wo unter dem Eindruck eines eindimensionalen Institutionenverständnisses und unter dem Primat der Wirtschaftlichkeit den von der Kirche als Institution erwünschten Botschaften Vorrang eingeräumt wird.
Damit einher geht eine Verengung dessen, was als kirchlicher Beitrag zum innerkirchlichen und gesellschaftlichen Diskurs gelten soll: Nämlich kirchenoffizielle Äußerungen aus Ämtern und Werken der verfassten Kirche, nicht aber die Vielfalt christlicher Stimmen in und um die Kirchen, die ebenso Anspruch auf Gehör und Würdigung verdienen. Das gilt im Besonderen dort, wo mündige Christenmenschen die Institution Kirche allgemein oder einzelne kirchliche Ausdrucksformen und Handlungsweisen kritisieren. Gut reformatorisch steht „sowohl das Recht als auch die Vollmacht, die Lehre zu beurteilen“ nicht „Bischöfen, Gelehrten und Konzilien“ zu, sondern „jedermann und allen Christen zusammen“.2
Eigennutz der Institution und gesellschaftliche Verantwortung, (Selbst-)Kritik und Öffentlichkeitsarbeit der Kirche(n) – in diesem Spannungsfeld arbeiten evangelische Publizist:innen.
Krisen der Evangelischen Publizistik
In das Tutzinger Schlusspodium habe ich als eine Beobachtung von der Tagung eingebracht, dass die Krisen der evangelischen Publizistik in den Tagungsbeiträgen wenn überhaupt nur am Rande zur Sprache gekommen sind. Eine prominente Ausnahme davon war ausgerechnet der Vortrag von des Präsidenten des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hans Ulrich Anke. In seinem Beitrag spielte der Begriff Krise natürlich vor allem deshalb eine große Rolle, weil er auch von den Krisen der verfassten Kirche sprach.
Transformation und Abbrüche des Glaubenslebens in Deutschland werden in der Institution Kirche als krisenhaft erlebt. Zahlreich sind die Bemühungen, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen oder doch wenigstens den Wandel zu begleiten. In jedem Fall will man unter Beweis stellen, dass es die Institution zur Verwaltung des Glaubenslebens schon noch immer braucht. Die Kirche bangt um ihre Relevanz.
Die Relevanzkrise der Kirche betrifft auch evangelische Publizistik. Sie wird mit der Kirche ohnehin „in einen Topf geworfen“, trotz aller Redaktionsstatuten, publizistischen Gesamtkonzepte und Distinktionen. Kirchen und christliche Medienunternehmungen bzw. -schaffende bilden in der pluralisierten Gesellschaft und ihrer neuen (gesamtdeutschen) Minderheitenposition zunehmend eine Schicksalsgemeinschaft – mit allen auch problematischen Implikationen, die das mit sich bringt. Ausgehend von seinen Überlegungen, die Publizistik als eine Funktion der Kirche zu verstehen, einen im Auftrag der Kirche geleisteten Dienst, inkludiert Anke sie in die Krise der Kirche. Wie die Kirche bangt auch ihre Publizistik um Relevanz, spürt den Vertrauensverlust und das schwindende Interesse.
Die evangelische Publizistik hat zudem Anteil an den Krisen des Journalismus und der Medienbranche. Hierzu zählen alle Krisenphänomene, die landläufig und ein wenig euphemistisch als Medienwandel beschrieben werden.3
Selbstverständnisse evangelischer Publizistik
Vielleicht versteht man die evangelische Publizistik sowieso am besten als Zwitterwesen auf der Grenze von Kirche und Medienbranche(n). Betrachtet man diese (Zwei-)Geschlechtlichkeit zudem nicht als Binarität, sondern als ein Spektrum, wird es möglich, Medien und Formate der evangelischen Publizistik zu verorten. Ein unabhängiger Journalismus – wie ihn z.B. der Evangelische Pressedienst (epd) als Nachrichtenagentur leistet – und die PR-Arbeit der Kirchen stehen sich als zwei Pole auf diesem Spektrum gegenüber. Sie sind – um bei der Definition des Dudens zu bleiben – „unvereinbar bei wesenhafter Zusammengehörigkeit“. Auch Kirchen-PR sollte sich, wie Ulrich H.J. Körtner ausgeführt hat, notwendig von den Tugenden „Wahrheitsliebe, Kritikfähigkeit und Freimut“ leiten lassen.4
In der traditionellen Kirchengebietspresse und anderen evangelischen Medien sind verschiedene journalistische, glaubenskommunikative und Public-Relations-Formate Teil eines einzigen Produkts. Das gilt nicht nur für die gedruckte wöchentliche Kirchenzeitung. Auch auf evangelisch.de werden Nachrichtenmeldungen des epd ausgespielt, es gibt zudem Andachten, Kolumnen und einen Konfirmandenspruch-Generator. Die Pfarrerinnen Ellen und Stefanie Radtke sprechen auf ihrem YouTube-Kanal Anders Amen, auch über (Kirchen-)Politik.5 Im Magazin zeitzeichen finden sich neben Meldungen, Analysen und Reportagen vor allem wissenschaftskommunikative Formate und selbst die Sonntagspredigt kommt im „Klartext“ zu Ehren.
Darüber, wo sich Medien der evangelischen Publizistik selbst auf diesem Spektrum verorten oder von ihren kirchlichen Auftraggebern verortet werden, gibt es notwendigerweise Auseinandersetzungen. Einer klaren Verortung wird eher ausgewichen. Das ist vor allem deshalb problematisch, weil es am Ende – oder: zuerst – um die Nutzer:innen-Rezeption gehen muss. Was habe ich eigentlich in der Hand, wenn ich die Kirchenzeitung aufschlage, auf evangelisch.de surfe oder in die Chrismon hineinschaue? Die Kennzeichnung mit winzigen Agentur- und Autor:innenkürzeln am Rande von Beiträgen reicht sicher nicht aus, um hier Klarheit herzustellen.
Auf der Tutzinger Tagung haben Roland Gertz und Ariadne Klingbeil je für ihren Beritt für mehr Kooperation geworben – im neuen „Campus Kommunikation“ der bayerischen Landeskirche bzw. im GEP als „Muskel der Landeskirchen“. Eine weitergehende Konsolidierung und Rationalisierung in der durch Kirchensteuermittel ermöglichten evangelischen Medienlandschaft ist wohl angesichts der sinkenden Kirchenmitgliedschaftszahlen unumgänglich. Zweifelsohne gibt es zwischen den verschiedenen Akteur:innen in den jeweiligen Landeskirchen und auch bundesweit noch Kooperationspotentiale, die wegen eines hinderlichen Kirchturmdenkens bzw. der typisch evangelischen Kleinstaaterei bisher nicht gehoben werden konnten. Ob die jetzige Leitungsgeneration daran wirklich etwas ändern will und kann? An Appellen zur Zusammenarbeit hat es in den vergangenen 20 Jahren nicht gemangelt, wohl aber an einer mutigen Umsetzung.
So notwendig eine vernetzte Content-Strategie ist, in der einmal im kirchlichen Auftrag und unter Verwendung von Kirchensteuermitteln erstellte Inhalte auch an anderer Stelle (zweit-)verwertet werden, so wichtig bleibt doch die klare Positionierung und Unterscheidbarkeit von unterschiedlichen Formaten und Produkten. Es muss sichergestellt werden, dass auch gelegentliche und mit dem Innenleben der Kirche nicht vertraute Konsument:innen „durchblicken“ können.
Am konkreten bayerischen Beispiel: Sollte ein Pfarrer:innen-Porträt aus der Werkstatt der landeskirchlichen Öffentlichkeitsarbeit wirklich nach der Veröffentlichung auf der Website der Landeskirche und ihren Social-Media-Kanälen auch noch auf der Titelseite der Kirchenzeitung stehen? Mir scheint, dadurch wird mit der ohnehin prekären Erwartungshaltung an Journalismus schludrig umgegangen.
Die Reichweitenkrise
Die augenfälligste Krise der evangelischen Publizistik ist die Reichweitenkrise. Sie wird zumeist beredt beschwiegen. Ariadne Klingbeil hat bei der Tutzinger Schlussrunde deutlich gemacht, von den ca. 40 Millionen Kirchenmitgliedern der beiden großen Kirchen würden durch kirchlich verantwortete Medien nur etwa 6 Millionen erreicht. Man muss sich der Deutung, dass evangelische Publizistik nur in diesen Medien zu finden sei, nicht anschließen, um feststellen, dass mit dieser Diagnose ein konkreter Missstand beschrieben ist.
An anderer Stelle6 wurde auf der Tutzinger Tagung auf den – offenbar kontroversen – Umstand hingewiesen, dass sich die Print-Auflage der Chrismon von 1,5 Millionen ihrer Verbreitung als kostenloses Supplement (Beilage) von Wochen- und Tageszeitungen verdankt. Es handelt sich dabei also um gekaufte Reichweite. Wie viele Leser:innen auf diesem kostenintensiven Weg überhaupt erreicht werden, lässt sich nur (qualifiziert) schätzen. In jedem Fall hat die Chrismon Anteil an der Milieuverengung der Wochen- und Tageszeitungen, deren Printausgaben außerdem von immer weniger Menschen abonniert, gekauft und gelesen werden.
Die gedruckte Kirchengebietspresse hingegen erreicht zumeist nur noch 1 oder 2 % der Kirchenmitgliedschaft. Die traditionellen Kirchenzeitungen stehen aufgrund von steigenden Kosten für Lieferung und Herstellung (Papier, Personal etc.) außerdem unter starkem finanziellen Druck. Ermöglicht wird deren Angebot durch Kirchensteuermittel, ohne die nirgendwo Mitarbeitende an der Erwirtschaftung eigener Einnahmen durch publizistische Produkte und andere Unternehmungen oder an der digitalen Transformation ihrer Medien arbeiten könnten. In einigen Landeskirchen wurde die gedruckte Kirchengebietspresse bereits eingestampft, anderswo steht sie unter verschärfter Beobachtung. In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (EVLKS) zum Beispiel steht Der Sonntag offen zur Disposition.
Erhebliche Teile dieser Zeitungen werden mit epd-Material gefüllt, das zum Zeitpunkt der Auslieferung häufig bereits online und ohne Bezahlmodell gelesen werden kann, nicht zuletzt auf evangelisch.de oder bei der digitalen Dachmarke einiger landeskirchlicher Zeitungen Evangelische Zeitung. Die Leser:innenschaft der gedruckten Kirchengebietspresse ist überaltert, in ihren Nutzungsgewohnheiten zwar außergewöhnlich treu, aber auch unflexibel. Den stetigen Verlust an Print-Abonnent:innen durch Online- oder E-Paper-Abos von jüngeren Leser:innen auszugleichen, ist keiner Kirchenzeitung bisher gelungen. An einigen Orten wurden diese zaghaften und wenig strategischen Versuche inzwischen ganz eingestellt.
Prekäre Lösungswege für die Printzeitungen
In vielen Landeskirchen (und römisch-katholischen Bistümern) wird darum ein Systemwechsel versucht: Weg von der wöchentlich erscheinenden Kirchenzeitung, hin zu monatlich oder noch seltener erscheinenden Print-Magazinen und -Zeitschriften, die entweder den bisherigen Abonnent:innen oder – wesentlich zielführender – allen Kirchenmitgliedern (unverlangt und unentgeltlich) zugesandt werden.
Dadurch ändert sich zwingend auch die Formatierung des Produkts. Statt an Nachrichtenmeldungen und kurzen Formaten festzuhalten, müsste mutig in den Formatbaukasten des Magazinjournalismus gegriffen werden: Längere Reportagen und Erklärstücke, hochwertige Bilder, eine wertige Gestaltung inklusive eines kostenintensiven Drucks auf gutes, festes Papier. Dabei handelt es sich um Veränderungen, die in den vergangenen zehn Jahren von den Redaktionen und kirchlichen Auftraggebern weitgehend verweigert wurden, obwohl sie längst durch die Entwicklung der digitalen Publizistik angezeigt waren. Die Versuchung ist zudem groß, ein solches neues kirchliches Periodikum ganz ohne kritischen Journalismus zu produzieren. Das kratzt nicht zuletzt am Selbstverständnis der bisher in den Kirchenzeitungen beschäftigten Journalist:innen.
Als Reaktion auf den Kostendruck wird in anderen Landeskirchen und Bistümern ein anderes Modell erprobt, das gleichwohl die Reichweitenkrise überhaupt nicht adressiert: In Kooperationen und durch Fusionen werden Teile der regionalen Kirchenzeitung gemeinsam mit Partnern aus anderen Landeskirchen und Bistümern erstellt. Ergänzt wird dieser gemeinsame Mantel dann durch einen eigenen Regionalteil. Dies gilt analog für die gedruckte Zeitung wie digital für E-Paper und/oder Websites.
Dadurch laufen die einzelnen Kirchenzeitungen Gefahr, ihr wichtigstes Alleinstellungsmerkmal einzubüßen: die regionale Berichterstattungskompetenz. Auch im Abonnementbezug ist wichtig, was auf dem Titel steht. Im Mantel solcher Produkte finden sich wie gehabt vor allem epd-Meldungen, die zuvor schon online erschienen sind, während eine Rumpfredaktion aus Pressemitteilungen und mit gelegentlichen journalistischen Eigenleistungen einen servicelastigen Lokalteil baut. Ein Blick in die nicht-kirchliche Regionalpresse zeigt: Das ist keine Dystopie, sondern bereits traurige Realität, die auch vor evangelischen Medien nicht Halt machen wird, wo sie nicht gar schon längst angekommen ist.
Der schwierige Sprung ins Digitale
Das Zeitfenster scheint sich außerdem geschlossen zu haben, in dem Kirchenmedien geeignete digitale Produkte entwickeln hätten können, um lokalen und regionalen Kirchenjournalismus zukünftig verkaufen zu können. Es gibt im deutschsprachigen Raum zwar vereinzelt Kirchenmedien-Apps, die Möglichkeit, sie für ein digitales Bezahlmodell zu nutzen und nutzer:innenorientiert Inhalte auszuspielen, wird allerdings nirgends ausgeschöpft.
Eine Neuentwicklung oder einen Einkauf bestehender technischer Lösungen können Kirchenmedien wohl nur im Verbund und/oder in Kooperation mit der verfassten Kirche stemmen. Ein verstärkter Kirchensteuermitteleinsatz dafür erscheint aber angesichts des abnehmenden Interesses und des Einsparungsdrucks in den Haushalten der Kirchen unwahrscheinlich. Schlussendlich stellt sich auch hier die Frage, welchem Zweck eine solche „Kirchen(nachrichten)-App“, die vollständig durch Kirchensteuern ermöglicht wird, eigentlich dienen soll: dem kritischen Journalismus oder der Mitgliederkommunikation der Kirche?
Die Reichweiten-Krise erstreckt sich nicht ausschließlich auf den Print-Bereich, sondern auch auf die Online-Publizistik. Selbst dort, wo sich Mitarbeiter:innen noch um Websites und E-Paper kümmern können, hängt die Kirchenpresse am Tropf der großen Social-Media-Plattformen, wenn es darum geht, den Content auch an die Konsument:in zu bringen. Ihr Verlangen nach Klicks und Reichweite liegt diametral zu den Interessen der Plattformbetreiber. Daran wird man auch durch eine dringend notwendige Verbesserung der Formate und Inhalte nichts ändern können.
Die Bemühungen der Redaktionen um Reichweite auf Instagram & Co. wirken zum Teil verzweifelt, wenn mit Clickbait-Überschriften auf (vermeintlich) kontroverse Themen aufgesprungen wird, gelegentlich auch grotesk. Zum Beispiel wenn die evangelisch.de-Redaktion Likes auf Instagram mit Spruchkacheln von Prominenten zum Thema Glauben generieren will. Die Zitate stammen zumeist aus Interviews mit anderen Medien (auf die nicht verlinkt wird), sind mehrere Jahre alt, daher vollständig entkontextualisiert. Garniert werden die Zitate mit einer gefälligen Gestaltung und einem einigermaßen aktuellen Porträtfoto der zitierten Person. Besonders bitter: Die wöchentlich ausgespielten „Promi-Kacheln“ gehören zu den wenigen erfolgreichen Beiträgen des evangelisch.de-Kanals. Sie werden immerhin von 5-10 % der ca. 40.000 Follower:innen des Kanals geliked.
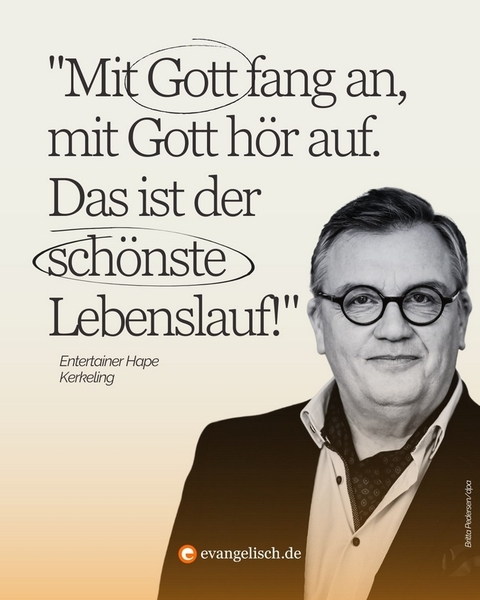
Instagram-Beitrag von evangelisch.de: „Der Entertainer Hape Kerkeling hat über seinen Glauben gesagt: „Mit Gott fang an, mit Gott hör auf. Das ist der schönste Lebenslauf!“ (Neue Bildpost, 2020)“
Im Vergleich zu solchen niedrigschwelligen Formaten fallen die Reichweiten von Eigenproduktionen der Kirchenmedien (Text, Audio, Video) erheblich ab. Insbesondere mit großem (finanziellen) Aufwand erstellte Podcasts und Videos erzielen zumeist nur wenige hundert Aufrufe – von einer nachhaltigen Nutzer:innenerfahrung ganz zu schweigen. Die vielfach in Anspruch genommene Medienförderung durch den Digitalinnovationsfonds der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und die Nutzung von Synergien mit landeskirchlichen Medienhäusern mögen auf der Kostenseite für Entlastung sorgen, zu einer Reichweitensteigerung führen sie nicht.
Das Ausspielen von Content direkt auf den Plattformen (vor allem auf Instagram und YouTube), das sich vornehmlich durch den kirchlichen Verkündigungsauftrag plausibilisiert, erweist sich zunehmend als Sackgasse, weil Konversionen in eine vertiefte Nutzung kirchlicher (Medien-)Produkte zumeist nicht stattfinden. Das kostenfreie und unverbindliche Angebot ist den Konsument:innen vielfach groß genug. Wie die „Digitale Communities“-Studie von midi bereits im Jahr 2022 gezeigt hat, muss auch die Wirkung der glaubenskommunikativen Social-Media-Formate für Mitgliedergewinnung und -Bindung der Kirchen differenziert betrachtet werden (s. hier in der Eule).
Auf den Plattformen konkurrieren evangelische Medienunternehmen mit weiteren Akteur:innen aus den Kirchen und anderen Medien um die Aufmerksamkeit der Nutzer:innen – mit zum Verwechseln ähnlichen, nicht selten völlig austauschbaren Inhalten. „Mehr Content“ und Zweitverwertungen als Kernbestandteile einer „neuen Contentstrategie“ sind für dieses Problem nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Stattdessen müsste sich die evangelische Publizistik von anderen Anbietern zum Beispiel durch eine dialogbereite Kommunikationshaltung absetzen, die dem Leitwert der Kommunikation eines „Evangeliums der Freiheit“ (Körtner) angemessen ist. Wo aber investieren kirchliche Medienhäuser und evangelische Medienunternehmen bewusst und strategisch in das Community-Management und die Nutzer:innen-Betreuung?
Wie die großen Social-Media-Plattformen mit den kostbaren, kirchensteuerfinanzierten Inhalten auf ihren Servern umgehen, steht zudem ganz in ihrem Gusto. Damit sind nicht zuletzt Fragen nach dem Selbstverständnis der evangelischen Publizistik und ihrer zwitterhaften Funktion für die Kommunikation des „Evangeliums der Freiheit“ und die demokratische Gesellschaft berührt. Kristin Merle hat die Kommodifizierung der Öffentlichkeit durch die Plattformen in ihrem Tutzinger Vortrag problematisiert (siehe auch hier in der Eule). Wird sie in der Praxis evangelischer Medien überhaupt als Problem anerkannt und adressiert?
Der Rundfunk als Vorbild?
Von der Reichweiten-Krise scheinbar unberührt ist die Fernseh- und Rundfunkarbeit als Teil der evangelischen Publizistik. Die vielfach öffentlich-rechtlichen Ausspielwege und verrechtlichten Sendeprivilegien bei privat-kommerziellen Anbietern unterscheiden dieses Handlungsfeld von der Print- und Online-Publizistik. Vielleicht lässt sich schon aus dieser Gegenüberstellung etwas für die zukünftige Gestaltung der digitalen Gesellschaft lernen?
Gleichwohl stehen die Privilegien der Kirchen zur Mitgestaltung von Rundfunk und Fernsehen durch ihr fortschreitendes Schrumpfen selbst in Frage und müssen wohl in den nächsten Jahren auf anderem Wege als mit Hinweis auf ihre schiere Größe plausibilisiert werden. Als Partikularorganisationen in einer pluralen Gesellschaft aber wird den Kirchen in einer öffentlich-rechtlich gestalteten Medienlandschaft auch in Zukunft ein – vielleicht kleinerer – Platz bleiben.
In einer schrumpfenden Kirche, die nicht mehr die gesellschaftliche Mehrheit repräsentiert, aber doch noch gerne Volkskirche bleiben will, ist die Frage nach der Reichweite nicht trivial: Evangelische Publizistik, die sich nicht am Kunden monetarisieren muss, sondern deshalb durch Kirchensteuermittel ermöglicht wird, weil sie „ein Beitrag […] zu einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft“ sein soll, wird sich nicht in Mitgliederkommunikation erschöpfen können. Sie zielt über die Mitgliedschaft der evangelischen Kirche hinaus. Zugleich bekämen die Kirchensteuerzahler:innen sicher gerne auch mal ein Medienprodukt zu sehen, das mit ihnen als mündigen Christ:innen und Kirchenmitgliedern rechnet.
Der Ernstfall: Missbrauch evangelisch
Wohin steuert die evangelische Publizistik? Wird sie zur Mitgliederkommunikation einer kleiner werdenden Kirche mutieren oder sich das Potential zur kritischen Befragung von Kirche und Gesellschaft gleichermaßen erhalten können? Muss nicht gerade wegen des Bedeutungsverlusts der Kirchen, mit dem ein wachsendes Desinteresse anderer Medien am (Innen-)Leben der Kirchen einhergeht, in die kritische, nach journalistischen Maßstäben operierende (Selbst-)Betrachtung der Kirchen investiert werden?
Kooperationen, Zentralisierungen und Rationalisierungen dürfen jedenfalls nicht allein nach Kostengesichtspunkten orientiert gestaltet werden, sollen „Wahrheitsliebe, Kritikfähigkeit und Freimut“ Leittugenden der evangelischen Publizistik bleiben. In der Praxis sind es derzeit vor allem die Berichterstattung und publizistische Verarbeitung des Skandals des sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche, an denen sich prüfen lässt, welchen Werten sich die evangelische Publizistik in der Praxis tatsächlich verpflichtet weiß – und wem sie zunächst und vor allem dienstbar ist.
Umfang und Struktur der sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie sind unterberichtet. Daran haben die Kirchenmedien über alle Formate und Produkte hinweg einen erheblichen Anteil. Auch mit und nach der „ForuM-Studie“ lässt sich feststellen, dass diese Lücke längst nicht geschlossen ist – und vielfach ernstzunehmende Versuche dazu auch unterbleiben. Mit der bloßen Weitergabe von kirchenamtlichen Stellungnahmen und Betroffenheitsadressen kirchenleitender Akteur:innen ist es sicher nicht getan. Nicht selten dürfen ehren- und hauptamtliche Kirchenleitende in Interviews und Sendungen Behauptungen über die Aufarbeitungsleistung ihrer Kirchen und das Engagement für Betroffene aufstellen, die völlig unhinterfragt bleiben.
Wenn die Medienarbeit der Landeskirchen in Zukunft „aus einer Hand“ kommt, muss man fragen, ob Journalist:innen in Diensten von Kirchenmedien überhaupt noch die innere und äußere Freiheit haben werden, ihre Kolleg:innen in den Pressestellen von Kirche und Diakonie und deren Arbeit kritisch zu hinterfragen – von ihren Chef:innen in den Landeskirchenämtern und Synoden ganz zu schweigen.
Die Missbrauchskrise ist selbstverständlich nicht das einzige Handlungsfeld, auf dem um die Zukunft der evangelischen Kirche gerungen wird. Sie ist deshalb besonders bedeutsam für die Institution und ihre Publizistik, weil in ihrem Zuge die Glaubwürdigkeit der Institution (noch mehr) in die Krise gerät. Kann man der Kirche und ihren Medien trauen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht?
Mit Berichten, Reportagen und Analysen über Fälle sexualisierter Gewalt, die Aufarbeitungsbemühungen der Kirchen, ihr vielfaches Scheitern an den eigenen Ansprüchen, über Reformen am kirchlichen Dienst- und Datenschutzrecht, über Synodenbeschlüsse und die Arbeit des EKD-Beteiligungsforums (BeFo) sowie Missbrauchsstudien lässt sich „im Betrieb“ der Institution Kirche und häufig auch bei den Leser:innen, Hörer:innen und Nutzer:innen kein Blumentopf gewinnen. Ihre Relevanz gewinnt die Arbeit an diesen Berichterstattungsgegenständen nicht durch einen möglichen Aufwuchs an Reichweite, sondern allein durch die Orientierung an den oben erwähnten Leittugenden evangelischer Publizistik. Wenn sie die ad acta legt, wozu braucht es sie dann eigentlich?
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.
Anmerkungen:
1 Die Geschichte der evangelischen Publizistik in der DDR wurde auf der Tutzinger Tagung von Professor Roland Rosenstock von der Universität Greifswald eingebracht. Lesenswert dazu auch der Beitrag von Karl-Christoph Goldammer im Buch zur Tagung über „‚Glaube und Heimat‘ in der DDR: Die Thüringer Kirchenzeitung zwischen 1946 und 1987“.
2 Martin Luther: „Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Vollmacht hat, alle Lehre zu beurteilen …“ (1523), in: DDStA Bd. 2, S. 389
3 Auf der Tutzinger Tagung wurden außerdem die Herausforderungen bedacht, vor denen (Massen-)Medien und ihre Konsument:innen durch die Ökonomisierung der digitalen Öffentlichkeit(en) (Vortrag von Prof. Kristin Merle von der Universität Hamburg) und durch digitale Trends und Hypes wie „KI“ (Vortrag von Rieke Harmsen vom Sonntagsblatt) stehen.
4 „Kirche und Medien – Das Evangelium der Freiheit“, Vortrag von Prof. Ulrich H.J. Körtner (Universität Wien), s. epd Dokumentation zur Tutzinger Tagung.>
5 „Anders Amen“ wird in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen produziert, gehört zum evangelischen Contentnetzwerk „yeet“ des GEP und wird vom Digital-Innovationsfond der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gefördert.
6 „Paradigmenwechsel in der Organisationskommunikation? Anfang und Ende der evangelischen Publizistik“, Vortrag von Prof. Roland Rosenstock (Universität Greifswald), s. epd Dokumentation zur Tutzinger Tagung.
