„Schöner glauben“ oder besser streiten?
Rechte Talking Points, Falschaussagen, Harmoniezwang: Der Influencer Nicolai Opifanti und das Scheitern des (christlichen) Online-Diskurses.
Der Streit um die inzwischen gescheiterte Berufung von Frauke Brosius-Gersdorf an das Bundesverfassungsgericht hat – angeheizt von einer ganzen Reihe rechtsradikaler Online-Portale – in diesem Sommer die Gemüter erhitzt. Auch christliche Influencer*innen nahmen das Thema auf. An Online-„Debatten“ mit Bezug zum Thema Schwangerschaftsabbruch nehmen für gewöhnlich evangelikale und (rechts-)katholische Influencer*innen teil, während die Mehrheit der christlichen und kirchlichen Accounts eher zurückhaltend agiert.
Umso erstaunlicher ist die deutliche Positionierung, die der landeskirchliche Influencer Nicolai Opifanti (@pfarrerausplastik) vorgenommen hat. Opifanti ist der bekannteste Online-Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (ELKWUE) und Teil des evangelischen Content-Netzwerkes „yeet“.
Dieser Artikel nimmt Opifantis Diskursbeiträge als ein Beispiel für die Probleme der (christlichen) Debattenkultur in den Blick: Wie lässt sich seine Position einschätzen? Was können wir daraus lernen, wie die digitale Debatte bisher geführt wurde? Vor welchen Herausforderungen stehen (progressive) christliche Influencer*innen, die für sich in Anspruch nehmen, den besseren Diskurs zu führen?
Reels und Podcast
Im Juli veröffentlichte Opifanti in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Beginn der Medienkampagne gegen die Kandidatur von Brosius-Gersdorf auf Instagram ein kurzes Video (Reel). Darin erklärte er, dass er die Positionen zur Menschenwürde von Brosius-Gersdorf aus christlicher Sicht für untragbar halte und rief in dieser Frage den status confessionis aus. Den Bekenntnisfall begründet er damit, im „jüdisch-christlichen Menschenbild“ basierend auf der Bibel sei seit 2000 Jahren klar, dass menschliches Leben bei der Zeugung beginne. Theolog*innen in früheren, „dunklen“ Zeiten hätten zu oft geschwiegen, als die Menschenwürde angefasst wurde.
In einem weiteren Beitrag kritisierte er das von ihm wahrgenommene Schweigen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zur Personalie Brosius-Gersdorf. Die EKD sei größtenteils politisch nicht mehr unabhängig genug, um christlich gebotene, „konservative“ Positionen zu vertreten. In den Kommentarspalten unter den Beiträgen wurde teils heftig diskutiert.
Einen Monat später, am 12. August, sprach Opifanti dann mit Peer Asmussen im Podcast von „Schöner glauben“, einem „progressiven“ christlichen Content-Netzwerk, ausführlich über die Frage, wie „politisch“ die Kirche sein dürfe. In dem als Interview beworbenen Gespräch ging es neben der Causa Brosius-Gersdorf auch um den Klimaschutz – und in einem Meta-Diskurs um die Bedeutung konservativer Stimmen in der (evangelischen) Kirche.
Unkommentierte Falschaussagen und rechtspopulistische Talking Points
In seinen Instagram-Posts verbreitet Opifanti eine Reihe falscher Behauptungen, die auch in dem gut 75-minütigen Podcast-Gespräch nicht hinterfragt werden. In seinem ersten Reel behauptet er, in 2000 Jahren Christentum sei aufgrund der Bibel klar gewesen, dass menschliches Leben mit der Zeugung im Mutterleib beginne. Dieses aus dem „Lebensschützer“-Milieu bekannte Narrativ projiziert die eigene Position in eine vielfältige Kirchengeschichte zurück, im Laufe derer unterschiedliche Modelle des Lebensbeginns entwickelt wurden und miteinander konkurrierten.
Opifanti dehnt seine Behauptung mittels eines Rückgriffs auf das sog. „jüdisch-christliche Menschenbild“ auch auf das Judentum aus. Das ist vor dem Hintergrund, dass im Judentum meist die Geburt als Beginn des Lebens gilt, schlichtweg falsch. Der Verweis auf eine angeblich lange jüdisch-christliche Tradition ist bei konservativen Akteur*innen beliebt, dabei geraten allerdings sowohl der Antisemitismus der christlichen Tradition als auch die Eigenständigkeit des Judentums zugunsten der Konstruktion einer verklärten europäischen Geschichte aus dem Blick. In einem nächsten Argumentationsschritt wird die herbeiphantasierte jüdisch-christliche Einigkeit dann gegen progressivere gesellschaftliche Entwicklungen oder einen als übermächtig wahrgenommene Islam verteidigt. Unterschiedliche politische Anliegen und Themen werden auf diese Weise in ein überspannendes Verfallsnarrativ eingebettet („Der Untergang des Abendlandes“).
Bemerkenswert ist auch Opifantis Urteil, „früher“ sei bei allen politischen und theologischen Auseinandersetzungen unter Christ*innen selbstverständlich gewesen, dass „der Geist Christi“ die Kirche einige. Im Nachhinein mag man tatsächlich versöhnlicher auf manche Auseinandersetzungen der Vergangenheit zwischen Pietisten und Liberalen innerhalb der evangelischen Landeskirchen blicken. Opifantis Behauptung jedoch, es sei keine Heilsfrage gewesen, ob man „auf dem Christustag oder auf dem Kirchentag“ gewesen sei, wirkt vor dem Hintergrund der harten Konfrontationen geradezu kitschig-verklärt.
Die nachherige Harmonisierung harter kirchlicher Auseinandersetzungen setzt Opifanti fort, indem er der Landessynode seiner Landeskirche trotz ihres breiten Spektrums an unterschiedlichen Positionen große Einträchtigkeit unterstellt. Heftige Konflikte so kleinzureden, ist nur dem möglich, dessen Position einen sicheren Rückzugsraum hat bzw. dessen Lebensführung eben nicht zur Debatte steht. Man frage die Mitglieder von „BunT fürs Leben“, einer Initiative für die „Trauung für Alle“ in der württembergischen Landeskirche, wie tolerant gegenüber Vielfalt und offen für queere Menschen und Pfarrpersonen sie die Stimmung auf den Synodentagungen wahrgenommen haben.
Opifantis Deutungen kirchlicher Auseinandersetzungen verbleiben ganz im Kontinuum des – in anderem Zusammenhang ausführlich beschriebenen – evangelischen Harmoniezwangs. Ausgerechnet in einem post-evangelikalen, „progressiven“ Format wie dem „Schöner glauben“-Podcast werden so die Verletzungen von Menschen verharmlost, denen von pietistisch bzw. evangelikal geprägten Glaubensgeschwistern ihr Glauben abgesprochen und deren Lebensführung als sündhaft markiert wurde. Asmussen weist nicht darauf hin, dass lgbtqi+ Personen gleichberechtigt Teil von Gemeinden sein sollten. Ihre Inklusion wird sogar als bedauerlicher Anlass für Spaltungen in Gemeinden geframed.
Im Podcast verteidigt Opifanti auch die Verschärfungen der Asylpolitik und die gemeinsame Abstimmung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag mit der AfD im Januar 2025. Ausdrücklich kritisiert er die Kritik von Evangelischer und Katholischer Kirche an dem parlamentarischen Manöver, dem Wortbruch von Friedrich Merz und die migrationspolitischen Stellungnahmen im Bundestagswahlkampf (zum Hintergrund hier, hier & hier in der Eule, Anm. d. Red.). Aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes könne man gute Argumente ableiten, erklärt Opifanti, warum Migration besser reguliert werden müsse, denn aus der Bibelstelle gehe klar hervor, dass es die Hauptaufgabe des Staates sei, seine Bürger*innen zu schützen.
All das aus der Aufforderung des Paulus an seine Glaubensgeschwister, der gerechten Obrigkeit untertan zu sein, herauszulesen, mutet der Bibelpassage allzu viel zu – und ignoriert obendrein die vielstimmige und breite Diskussion über Römer 13, die vor allem im 20. Jahrhundert und „nach Auschwitz“ geführt wurde. Eine Begründung seiner Exegese legt Opifanti im Podcast nicht vor. Seine Unterstellung, die aktuelle Menge an Asylsuchenden gefährde die Sicherheit der Bürger*innen, wird weder als sachlich unzutreffend zurückgewiesen noch meta-diskursiv als rechtspopulistischer Talking Point problematisiert.
„Die EKD“ als Popanz und Feindbild
In seinen Reels und im „Schöner glauben“-Podcast schießt sich Opifanti auf „die EKD“ als Feindbild ein. Die Kritik an „der EKD“ nutzt er, um sich selbst als isoliert außerhalb des kirchlichen Mainstreams stehend zu präsentieren. Viele Hörer*innen werden mit den Strukturen der evangelischen Landeskirchen und der EKD als ihrer Gemeinschaft mit eigenen Organen nicht vertraut sein. Opifanti und Asmussen stellen die unterschiedlichen Ebenen, Akteur*innen und ihre Rollen leider auch nicht transparent dar, sondern verbreiten das Narrativ, „die Evangelische Kirche“ bzw. „die EKD“ sei eine einheitliche Institution, in der von oben nach unten durchregiert werden könnte – und wird.
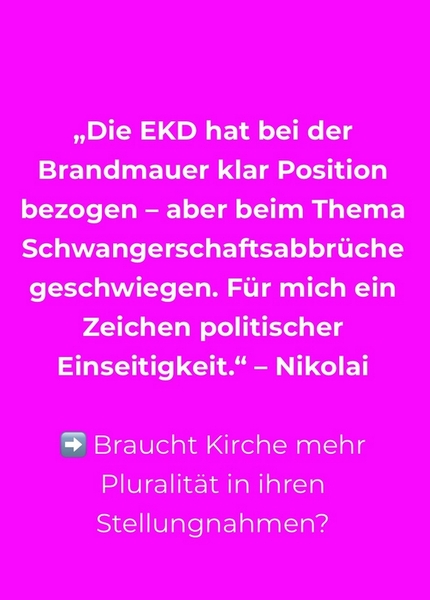
Instagram-Post von „Schöner glauben“ zur Podcast-Episode mit Zitat von Nikolai (sic!) Opifanti.
Dies stiftet erhebliche Verwirrung, weil so völlig offen bleibt, wer eigentlich Sender und Empfänger der von Opifanti kritisierten kirchlichen Äußerungen ist, mit welcher Intention und unter welchen Bedingungen verschiedene Kommunikationsformate wie kirchliche Stellungnahmen in Gesetzgebungsprozessen, Denkschriften oder auch Predigten verfasst werden. So bezeichnet Asmussen zum Beispiel die Büros der katholischen und evangelischen Bevollmächtigten im politischen Berlin fälschlicherweise als Pressestellen. Opifantis verkürzende und theologisch fragwürdige Ausführungen zum Verhältnis von Offenbarung, Schrift und „politischer“ Predigt bedürften eigentlich einer eigenen kritischen Auseinandersetzung.
„Der EKD“ jedenfalls wirft er im Verlauf des Gesprächs das gesamte Arsenal rechtspopulistischer Anschuldigungen vor, das aus den Debatten der vergangenen Jahre umfänglich bekannt ist: Die EKD habe unreflektiert Positionen der „Letzten Generation“ in eigene Dokumente übernommen und mit der Vorgabe eines „Tempolimits“ die eigene Ekklesiologie verraten (Hintergrund siehe hier in der Eule). Eine Erklärung, was an den Forderungen der „Letzten Generation“ – z.B. Gesellschaftsräte, Schutzpflicht des Staates gegenüber zukünftigen Generationen – der evangelischen Kirchenlehre widerspräche, bleibt Opifanti den Hörer*innen leider schuldig. Wird die „Letzte Generation“ hier nicht nur deshalb in die Diskussion eingebracht, um die weitverbreitete Ablehnung ihrer Protestformen zu reaktivieren und emotional auszuschlachten?
Im Podcast schlägt Asmussen zur Befriedung des Konflikts vor, „die Kirche“ solle statt auf Interventionen in die Politik als Landbesitzerin Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Dabei wird übersehen, dass eben nicht „die EKD“, sondern andere kirchliche Institutionen als Verpächterinnen von Kirchenland in Erscheinung treten. Neuere Entwicklungen bei der kirchlichen Landnutzung und beim Klimaschutz in den Kirchen werden aufgrund eigener Unkenntnis nicht ins Gespräch eingebracht. Das bereits bestehende Engagement der Kirche wird so unsichtbar gemacht. „Die EKD“ bzw. „die Kirche“ erscheint als unglaubwürdige Akteurin in der politischen Auseinandersetzung, die notwendige Veränderungen nur fordert, aber selbst nicht in Angriff nimmt.
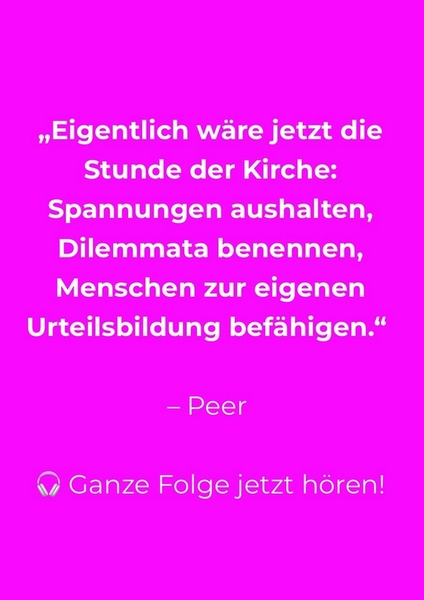
Instagram-Kachel zur Podcast-Folge von „Schöner glauben“ mit Zitat von Peer Asmussen.
Im Podcast vertritt Opifanti von Asmussen unwidersprochen die diffuse Position, „die EKD“ sei an sich zu links und Konservative hätten in ihren Gremien keinen Platz mehr. Die Rede von der „linksgrünen EKD“, um sich als konservativer oder rechte*r Akteur*in als marginalisiert zu framen, entbehrt jeder Grundlage. Skandalisiert wird damit eigentlich nur die klare Positionierung der Evangelischen Kirche gegen Rechtspopulismus und -Radikalismus. Innerkirchliche Vielfalt, die auch konservative und rechte Positionen umfasst, wird absichtlich unsichtbar gemacht. Im Rat der EKD wirkt zum Beispiel Thomas Rachel (CDU, MdB), der Beauftragte der Bundesregierung für Religionsfreiheit. Er hat sowohl dem „Fünf Punkte Plan zur Migration“ seiner Fraktion als auch dem „Zustrombegrenzungsgesetz“ und der Aussetzung des Familiennachzuges für Menschen mit subsidiärem Schutz zugestimmt — stets im Widerspruch zur Positionierung der EKD.
Besonders ärgerlich ist die oberflächliche Kritik an „der EKD“ bei jenem Thema, das den eigentlichen Anlass für das Podcast-Gespräch und die Einlassungen Opifantis zur Personalie Brosius-Gersdorf auf Instagram darstellt: Die Debatte um eine Reform der Gesetzgebung des Schwangerschaftsabbruchs. Denn anders als von Opifanti mehrfach skandalisiert, haben sich die EKD, seine eigene Landeskirche und weitere evangelische Akteur*innen und Organisationen in den vergangenen zwei Jahren ausführlich, intensiv und differenziert zum Thema geäußert (wir berichteten). Einer ersten Stellungnahme des Rates der EKD gegenüber der von der Ampel-Regierung eingesetzten „Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ folgte nicht nur eine kontroverse Auseinandersetzung (s. hier, hier, hier & hier in der Eule), sondern nach einer Debatte auf der EKD-Synode die Beauftragung an das EKD-Kammernetzwerk, sich noch einmal eingehend mit dem Themenfeld zu befassen.
Als Ergebnisse dieser Arbeit veröffentlichte die EKD im Dezember 2024 eine Stellungnahme zum (damals aktuellen) Gesetzgebungsverfahren und eine 50-seitige als „theologisch-ethischer Diskussionsbeitrag“ bezeichnete Orientierung (mit einer 4-seitigen Zusammenfassung, PDF, wir berichteten). An der Entstehung waren Expert*innen aus Theologie, Kirche und Diakonie beteiligt – unter anderem auch Opifantis württembergischer Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, der die Positionierung des Rates der EKD zuvor deutlich kritisiert hatte.
Diskursinszenierung mit Chuzpe
Diese neuesten evangelischen Stellungnahmen wurden von Opifanti und Asmussen offensichtlich ebenso wenig rezipiert wie andere Debattenbeiträge der vergangenen Jahre. Wie sonst können sie behaupten, in kirchlichen Stellungnahmen würden die Dilemmata im Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch nicht wahrgenommen? Von diesen Dilemmata ist bereits in den ersten Absätzen beider Dokumente ausdrücklich die Rede!
Opifanti und Asmussen behaupten, dass sich im Diskurs über den Schwangerschaftsabbruch „zwei Lager“ in Fundamentalopposition „anschreien“. Entsteht ein solcher Eindruck vielleicht dadurch, dass hoch-emotionalisierende Stellungnahmen von rechtsradikalen evangelikalen Influencer*innen und Social-Media-Diskussionen die einzigen Teile des Diskurses sind, die von den Gesprächspartnern wahrgenommen und der Diskussion würdig befunden werden?
Ihnen beiden jedoch, stellen Opifanti und Asmussen freudig fest, sei es im Unterschied zu den unversöhnlich Streitenden möglich, ohne unzulässige Emotionalisierung die Lage abzuwägen. Opifanti erklärt stolz, dass es für die Zuhörer*innen womöglich überraschend sei, dass er als CDU- und Asmussen als DIE LINKE-Mitglied beim Thema Abtreibung einer Meinung sein könnten – so als ob das sonst nie vorkäme. Weil sie selbst nicht betroffen sind, erklären sie, sei es ihnen möglich, mit kritischer Distanz auf das Thema zu schauen.
Damit inszenieren sie sich als Männer, die aufgrund ihrer Unbetroffenheit rational-sachlich diskutieren können. Die Positionen betroffener Personen werden so ausgeblendet oder sogar als hysterisch zurückgewiesen. Diese auf Geschlechterstereotypen basierende Überlegenheitsinszenierung wird durch das virtue signaling der beiden – sie betonen, sie würden sich als Männer eigentlich sonst nicht zu Schwangerschaftsabbrüchen äußern – nur noch unangenehmer.
Ist diese Diskussion wirklich besser als der evangelische Durchschnittsdiskurs über den Schwangerschaftsabbruch, von dem Männer – nicht nur Bischöfe und Theologieprofessoren – explizit nicht ausgeschlossen sind, in den Diskussionsbeiträge aber qua Amt und Kompetenz eingebracht werden? Was soll das virtue signalling als besonders achtsame Männer, wenn dann weder maßgebliche kirchliche Stellungnahmen noch die Positionen von betroffenen Personen einbezogen werden?
Stattdessen stellt Asmussen die Sachlage mindestens entstellend verkürzt dar, indem er behauptet, die aktuelle Rechtslage zum Schwangerschaftsabbruch sei entstanden, weil das Bundesverfassungsgericht entschieden hätte, ungeborenes Leben könne aufgrund der Menschenwürde nicht einfach so beendet werden. Später dann hätte man gemerkt, dass Frauen auch ein Recht haben, über ihren Körper zu bestimmen, und man sie nicht zwingen dürfe, ein Kind auszutragen, wenn sie dadurch in Lebensgefahr gerieten, so sei die Fristenlösung entstanden.
Angesichts einer solch umfassenden Unkenntnis über die Hintergründe der gegenwärtigen Gesetzgebung und die politische Auseinandersetzung um den Schwangerschaftsabbruch, kann die Behauptung der Gesprächspartner, in der aktuellen Diskussion würde kaum eine*r noch die ethischen Dilemmata sehen und Kompromisse suchen, nicht wirklich verblüffen. Beides trifft natürlich nicht zu, wie die kirchlichen Stellungnahmen (s.o.) und zahlreiche weitere Debattenbeiträge von Frauenverbänden, Jurist*innen, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen unterschiedlicher Überzeugung hinlänglich beweisen – wenn man sie denn zur Kenntnis nehmen würde.
An einigen Stellen des Gesprächs betont Podcast-Host Peer Asmussen – das soll hier der Fairness halber nicht unerwähnt bleiben – sich bei manchen der (spontan) aufgerufenen Themen nicht gut auszukennen. Der Mangel an grundlegender Sachkenntnis führt jedoch dazu, dass Sachverhalte verzerrt dargestellt werden und faktisch falsche Aussagen des Gesprächspartners im Raum stehen bleiben. Verstärkt wird dies auch durch mehrfache meta-diskursive Aufrufe beider Gesprächspartner an die Hörer*innen, während Diskussionen auf Social-Media-Plattformen andere Menschen nicht zu beleidigen, die immer wieder vom eigentlich strittigen Thema wegführen.
Bewundernswert ist die Chuzpe, mit der Opifanti und Asmussen die fehlende Faktenprüfung, die ausbleibende Kontroverse und die sich daraus ergebende Harmonie zwischen ihnen auch noch als Stärke ihrer Diskussion darstellen, die sich so dem restlichen kirchlichen und gesellschaftlichen Diskurs als überlegen erweise.
Selbstviktimisierung der Konservativen
Das führt uns zurück zur Instagram-Diskussion um Opifantis Stellungnahmen: Denn seine Appelle zur kirchlichen Selbstkritik im „Schöner glauben“-Podcast stehen in krassem Kontrast zu seinem eigenen Umgang mit Kritik, die er durchgehend als „Shitstorm“ bezeichnet. Bei seinen Kritiker*innen hätten sich wohl – dummerweise! – aufgrund seiner Beiträge Assoziationsketten mit radikal-christlichen Influencer*innen gebildet. Sie seien schlicht nicht in der Lage gewesen, seine Posts richtig zu lesen, seine Position zu verstehen und begründete, sorgfältige Kritik vorzubringen
Der Kritik an seinen Posts wird er so nicht gerecht. Auf Hinweise darauf, dass die (theologischen) Positionen innerhalb der Evangelischen Kirche und die Positionierung der EKD differenzierter ausfallen als von ihm dargestellt, geht er ebenso wenig ein, wie auf Kommentator*innen, die erklären, dass Abtreibungsgegnerschaft eine inhaltliche Brücke zwischen konservativen Christen und Rechtsextremen bildet, oder Mahnungen, seine Beiträge würden zur Welle der Diffamierung von Brosius-Gersdorf beitragen.
Stattdessen inszeniert sich Opifanti als Konservativer in der Evangelischen Kirche selbst als Diskursopfer, dem böse Unterstellungen gemacht werden. Das Machtgefälle zwischen ihm als Influencer und Pfarrer und den kommentierenden Nutzer*innen wird geleugnet. In ähnlicher Manier behauptet er im Podcast, von Pfarrkolleg*innen wegen seiner CDU-Mitgliedschaft nach der gemeinsamen Abstimmung der CDU/CSU- und AfD-Fraktionen im Bundestag aus der christlichen Geschwisterlichkeit ausgeschlossen geworden zu sein und vergleicht dies mit einer Exkommunikation im Mittelalter. Zugleich sieht er in der Frage des Schwangerschaftsabbruches einen Bekenntnisfall eingetreten. Ohne die richtige, konservative Haltung zu diesem einzunehmen sei eine Kirchengemeinschaft also nicht mehr möglich.
Opifantis Diskurshaltung ist daher ein gutes Beispiel für die Selbstviktimisierung von konservativen und rechten Akteur*innen in der Kirche: Während man sich selbst mit Hilfe von Falschaussagen an einer Kampagne gegen angeblich zu linke Akteur*innen und/oder Positionen beteiligt, stellt man sich selbst als Opfer missgünstigen Framings dar, sobald die eigene Position kritisiert wird. Die Forderungen nach Selbstkritik der vorgeblich „linksgrünen“ Kirche und nach größerem, heute angeblich nicht existierendem Meinungspluralismus, dienen der Legitimierung der eigenen Position und dem Versuch, dieser einen (noch) dominanteren Platz im Diskurs zu verschaffen, ohne sachliche Argumente liefern zu müssen, die diesen rechtfertigen würden.
Besser streiten
Dass ein progressiver Podcast, der zur Stärkung der Demokratie auch unbequeme Fragen stellen und „sich für einen anständigen und fundierten Diskurs“ einsetzen möchte, bereitwillig und ohne kritische Nachfragen Platz für die Fortsetzung einer solchen Selbstdarstellung bietet und sogar nahelegt, es handele sich dabei um den besseren Diskurs, ist ein Armutszeugnis für die „progressiv“-christliche Debattenkultur auf Social-Media-Plattformen. Leider kein Einzelfall, aber doch so signifikant, dass sich eine tiefergehende Befassung damit lohnt. Was können wir lernen?
Eine sachlich-kontroverse Auseinandersetzung mit Opifanti über seine zahlreichen Behauptungen und Vorwürfe bleibt ein Desiderat. Man kann sich fragen, ob es überhaupt nötig ist, einem auch innerhalb der christlichen Bubbles auf Instagram eher kleinen Influencer so auf den Zahn zu fühlen. Wir sollten christliche Influencer*innen und Content-Netzwerke aber nicht allein ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Publikumswirkung wegen, sondern auch aufgrund des von ihnen selbst formulierten Anspruchs als Diskursteilnehmer*innen ernstnehmen.
Um wirklich besser miteinander zu streiten, ist es notwendig, dass sie aus der Welt selbstbezüglicher Instagram-Debatten herausfinden, die tatsächliche Sach- und Diskurslage und Fach- und Betroffenenperspektiven zur Kenntnis nehmen und würdigen. Nur so können sie ihren selbstbewusst formulierten mission statements und (nicht gerade selten) auch ihrem kirchlichen Dienstauftrag gerecht werden.
Es geht also darum, wirklich in der Sache zu streiten und nicht auf einen inhaltlich vagen Meta-Diskurs auszuweichen, so dass man auch bei sich widersprechenden inhaltlichen Positionen durchgehend harmonische Eintracht inszenieren kann. Das ist anstrengend, macht angreifbar und passt nicht knackig-sexy formuliert auf wenige Instagram-Kacheln. Sich als besseren Diskurs darstellen, während man gerade in die Falle evangelischer Harmoniesehnsucht tappt, geht nicht. Wer eine Kirche verlangt, in der politisch kontrovers gestritten wird und Menschen trotzdem geschwisterlich beieinander sein können, sollte in seiner eigenen Diskussionskultur genau das vorleben.
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.
