Rechtfertigung nach der „ForuM-Studie“: Gnade und Wahrheit
Die „ForuM-Studie“ problematisiert einen angeblichen Automatismus von Schuld und Vergebung in der Evangelischen Kirche. Wie können wir mit dem Verdacht umgehen, dass die reformatorische Rechtfertigungslehre toxisch ist?
Seit Veröffentlichung der „ForuM-Studie“ zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche und Diakonie wird diskutiert, welche Konsequenzen aus den bestürzenden und für engagierte Mitglieder der evangelischen Kirchen auch beschämenden Befunden zu ziehen sind. Die Forscher:innen weisen selbst auf verschiedene Ermöglichungsfaktoren hin, die es Tätern in evangelischen Kirchengemeinden und in Diensten und Werken der Kirche leichter gemacht haben, ihre Taten zu begehen und zu vertuschen – und die dafür gesorgt haben, dass Betroffenen nicht angemessen Gehör geschenkt wurde.
Einige dieser Faktoren betreffen nahezu alle oder die meisten religiösen wie nicht-religiösen Organisationen. Bei vielen liegt nahe, dass – anders als oft behauptet oder stillschweigend vorausgesetzt – kein maßgeblicher Unterschied zwischen der evangelischen und katholischen Kirche besteht. Zu nennen wäre etwa ein in beiden Kirchen verbreiteter Klerikalismus, der Geistliche beider Konfessionen mit einem Lichtglanz der Nicht-Kritisierbarkeit umgibt.
Ein interessanter Sonderfall liegt allerdings bei einem Ermöglichungsfaktor vor, den die Autor:innen der Studie in ihrer Zusammenfassung (PDF) selbst eher als offene Frage markieren. Es geht um die Auswirkungen der spezifisch reformatorischen Rechtfertigungslehre auf den in der Kirche gelebten Umgang mit Schuld und Vergebung:
„Die Annahme eines scheinbaren Automatismus von Schuld und Vergebung/Gnade lässt sich als Mechanismus der evangelischen Rechtfertigungslehre lesen. Es kommt zu einer Verkopplung von Schuld und Vergebung: Reue wird übersprungen oder findet keine angemessene Form; Betroffene werden mit Wünschen nach Vergebung der sexualisierten Gewalt konfrontiert, bevor eine angemessene Auseinandersetzung mit der Schuld umgesetzt wurde; Schuld als nicht prinzipiell auflösbarer Zustand kann offenbar im evangelischen Selbstverständnis nicht ausgehalten werden.“
Es versteht sich eigentlich von selbst, dass mit diesem Befund kein Stich im Wettstreit der Konfessionen zu machen ist. Angesichts zahlreicher gut dokumentierter Übergriffe im Umkreis der katholischen Buß- und Beichtpraxis erscheinen römische Positionen wohl kaum als weniger anfällig. Dieser Hinweis auf eine überkonfessionelle Gemeinschaft des Versagens wiederum nimmt der Kritik an den einzelnen kirchlichen Traditionen nichts von ihrer Stichhaltigkeit. Wie also ist angemessen mit dem Verdacht umzugehen, dass die spezifisch reformatorische Gestalt der Rechtfertigungslehre eine mitunter fatale Wirkung auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt entfaltet haben könnte?
Wie ernst ist uns die Rechtfertigungslehre?
Im kirchlichen Alltag sowie in der publizistischen Bearbeitung lassen sich verschiedene Ausweichbewegungen beobachten. Zunächst kann man sich darauf zurückziehen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Rechtfertigungslehre und kirchlichem Umgang mit Schuld und Vergebung schwer nachweisbar ist. Damit würde man allerdings die kirchliche Prägekraft zentraler theologischer Einsichten der Reformation gerade dort in Frage stellen, wo ein solcher Zusammenhang nicht nur theologisch behauptet, sondern tatsächlich einmal von der nicht-theologischen Forschung hergestellt wird.
Des Weiteren kann man in einer Art abstraktem Dogmatismus darauf bestehen, dass es sich hier gerade nicht um eine angemessene Form der authentischen Rechtfertigungslehre handelt, sondern um ein Missverständnis oder sogar einen bewussten Missbrauch der reformatorischen Theologie handelt. So könnte man den Versuch einer Verteidigung der Rechtfertigungslehre durch Johannes Fischer lesen (s. #LaTdH vom 11. Februar 2024). Das allerdings wirft die Frage auf, warum solche Fehlinterpretationen irgendwie plausibel erscheinen und offenbar sogar in der Kirche einigermaßen weit verbreitet sind.
Tatsächlich war es ja bereits in der Reformationszeit nicht der Fall, dass aus dem dogmatisch-richtigen Verständnis der Rechtfertigungslehre gleich eindeutige Konsequenzen für das kirchliche Leben abzuleiten waren. Ist die gemeinreformatorische Rechtfertigungslehre in ihrem Kern auch von großer Klarheit, bleiben dennoch die lebenspraktischen Konsequenzen notorisch umstritten, die aus dieser Grundeinsicht zu ziehen sind.
Reformatorische Grundlagen und gegenwärtige Tendenzen
Ausgangspunkt der reformatorischen Rechtfertigungslehre war die Kritik an einer spätmittelalterlichen Bußpraxis, die eine Wiederherstellung des beschädigten Gottesverhältnisses an verschiedene Bedingungen geknüpft hatte – die wiederum zumindest im Fall der zeitlichen Sündenstrafen kirchlich verwaltet wurden. Dabei kommt es zu einer verhängnisvollen Verwischung: Die Beichtbeziehung zum Amtsträger, das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft der Kirche, das Verhältnis der Einzelnen zu Gott und möglicherweise auch das Verhältnis zwischen Täter und Opfer überlagern sich so, dass das Beziehungsgeflecht jenseits gelehrter Traktate kaum zu entwirren ist.
Die reformatorische Rechtfertigungslehre dagegen fokussiert den Sündenbegriff entschieden auf das Gottesverhältnis: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“ Die Wiederherstellung der durch die Sünde beschädigten Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf wird allein Gottes Gnade zugeschrieben – und zwar um Jesu Christi willen, ohne vorangehende oder nachfolgende Bedingungen. Ergriffen wird die Vergebung im glaubenden Vertrauen. Wer Menschen die Vergebung ihrer Sünde zuspricht, fällt kein eigenes Urteil, sondern überbringt schlicht eine Frohe Botschaft von Gott:
„Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern daß wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade um Christi willen durch den Glauben“ (Augsburger Bekenntnis Art. 4).
„Gott ruft durch sein Wort im Heiligen Geist alle Menschen zu Umkehr und Glauben und spricht dem Sünder, der glaubt, seine Gerechtigkeit in Jesus Christus zu. Wer dem Evangelium vertraut, ist um Christi willen gerechtfertigt vor Gott und von der Anklage des Gesetzes befreit.“ (Leuenberger Konkordie 10)
Am konzentriertesten tritt dieser Zusammenhang dort hervor, wo im Gottesdienst im Zuge des Beichtrituals ein gemeinsames Schuldbekenntnis gesprochen wird, auf das liturgisch die Vergebungszusage folgt. Allerdings ist gegenwärtig zu beobachten, dass diese Form der gottesdienstlichen Beichte im evangelischen Bereich immer seltener wird. Sowohl das Vorbereitungsgebet nach Art des klassisch-lutherischen Confiteor als auch der eher reformierte Brauch einer Beichte in der Hinleitung zum Abendmahl gilt mittlerweile nicht mehr als Normalfall, sondern eher als traditionalistisches oder gar katholisierendes Statement. In vielen Gemeinden ist die Verwendung gottesdienstlicher Beichtformeln auf spezielle Anlässe wie den Sonntag Invocavit, Karfreitag, den Vorabend der Konfirmation oder den Buß- und Bettag beschränkt.
Ist in traditionellen Beichtliturgien am ehesten ein Automatismus von Schuld und Vergebung zu greifen, prägen gerade diese Rituale derzeit keinesfalls die evangelische Frömmigkeitskultur. Es erscheint daher nicht sinnvoll, an dieser Stelle anzusetzen. Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass sich gerade in der Abkehr von diesen Formen ein kirchlicher Kulturwandel dokumentiert, der auch das Verständnis der Rechtfertigungslehre beeinflusst. Dieses Verständnis wiederum ist in den Blick zu nehmen, wenn man der Anfrage der Autor:innen der „ForuM-Studie“ Rechnung tragen will.
Vergebung der Sünde und Schuld gegenüber Mitmenschen
Man kann grundsätzlich bezweifeln, ob „Automatismus von Schuld und Vergebung/Gnade“ korrekt beschreibt, was sich im Geschehen der Rechtfertigung zwischen Gott und Mensch abspielt. Unabhängig davon geht es bei der Rechtfertigung allein aus Gnade zunächst eben gar nicht um das Verhältnis zwischen Menschen – und sei es zwischen Tätern und Opfern. Die durch Rechtfertigung ermöglichte Wiederherstellung eines Gottesverhältnisses und damit auch die Rückkehr in die Gemeinschaft des Glaubens kann ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu Versöhnung und Vergebung zwischen Menschen sein. Direkt oder gar automatisch gekoppelt sind beide Ebenen nicht.
Vieles spricht dafür, dass die klassischen Beichtformeln der wichtigen Unterscheidung dieser Ebenen besser gerecht werden als modernisierte Vergebungsrituale, die zugunsten eines ethisierenden Schuldbegriffs auf den theologischen Sündenbegriff verzichten. Dies führt schnell zu einer erneuten Verwischung von Gottesverhältnis und zwischenmenschlicher Beziehungsebene, die in der Folge tatsächlich einem Vergebungsautomatismus gegenüber Tätern Vorschub leisten kann. Trotzdem kann auch liturgischer Konservatismus nicht völlig vor solchen Verwischungen schützen. Denn es ist zuzugestehen, dass sich die strikte Trennung von Gottesverhältnis und zwischenmenschlichen Beziehungen gar nicht durchhalten lässt.
Auf Grundlage der biblischen Schriften – „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott“ (Leviticus 19,2) – leuchtet überhaupt nicht ein, dass wir uns in unserem ethischen Verhalten nicht an Gott orientieren sollen. Schon im Vaterunser heißt es: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ (Matthäus 6,12). Und bei vielen Trauerfeiern wird im sogenannten Abschied gesprochen: „Und wem er/sie wehgetan haben sollte, verziehe ihm/ihr, wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten“. Mindestens so oft, wie im Gottesdienst eine Differenz zwischen göttlicher und menschlicher Vergebung zur Darstellung kommt, wird diese Differenz im Namen eines christlichen Liebes- und Geschwisterlichkeitsethos wieder kassiert!
Tatsächlich ist auch die reformatorische Rechtfertigungslehre darauf angelegt, dass wir unser Verhalten den Mitmenschen gegenüber an einem gnädigen Gott und dessen Bereitschaft zur Vergebung orientieren. An einem Gott, der bedingungslos in eine neue Beziehung mit den Sünderinnen und Sündern tritt. An diesem Anspruch ändert sich nichts, nur weil dabei hoffentlich immer mitgesetzt ist: Wir bleiben hinter diesem göttlichen Ideal im Normalfall weit zurück, weil wir eben Menschen sind und nicht Gott.
Eine Kultur des Wegwischens?
Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, wenn dieser innere Zusammenhang von Gottesbeziehung und Vergebungsbereitschaft sich in einer kirchlichen Kultur niederschlägt. Eine Kultur des Umgangs, die sich in ihrer Selbstbeschreibung als fehlertolerant, vergebungsbereit, versöhnlich beschreibt. Es ist der Anspruch unserer Kirchengemeinden, ein Raum zu sein, in dem nicht nur gottesdienstlich die Vergebung durch Gott erlebbar wird, sondern auch ein gnädiger Umgang miteinander gepflegt wird. Wir leiden allgemein eher darunter, diesen Anspruch nicht zu erfüllen, als darunter, dass wir ihn übererfüllen. Der Priester im Actionfilm, der mit den Worten: „Gott vergibt, aber ich bin nicht Gott!“, seine Schrotflinte nachlädt, ist für die meisten Christenmenschen kein Rollenvorbild, sondern wird als witzige Karikatur durchschaut.
Wie also ist auf dieser Grundlage der Kritik durch die „ForuM-Studie“ zu begegnen? Ist der Automatismus als fatale Wirkung einer auch ethisch orientierungskräftigen Rechtfertigungslehre einfach hinzunehmen? Dann müsste man die leidvollen Erfahrungen vieler Betroffenen mit dieser spezifischen evangelischen Kultur wegwischen – oder besser aufhören, evangelisch zu sein. Stattdessen legt sich eine andere Konsequenz nahe:
Tatsächlich können Geschwisterlichkeitsethos und Rechtfertigungslehre zu einer reichlich klebrigen Harmoniekultur zusammenfinden, die in den evangelischen Kirchen leider weit verbreitet ist. Diese Kultur klammert möglichst alle sozialen Gegensätze aus, deutet echte Konflikte in Missverständnisse um, sediert den Zorn von Benachteiligten und schützt eben potenziell auch Täter, während sie laute Opfer leicht als Störenfriede brandmarkt. Diese Harmoniekultur schleicht sich besonders dort ein, wo das theologische Gegengewicht zur Gnade fehlt.
Für das hier notwendige Gegenstück kann das biblische Gottesbild sensibilisieren. So stellt sich Gott Mose folgendermaßen vor:
„Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied.“ (Ex 34,6 f.)
Die Psalmen besingen: „Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja!“ (Ps 117,2). Und im Johannesevangelium wird diese Tradition aufgenommen: „eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). Gnade ganz ohne Gericht, ohne Wahrheitsfindung ist bei diesem Gott nicht zu haben. Es ist heute selbstkritisch zu fragen, ob wir nicht häufig die ganz große Gnade ohne dieses notwendige Gegengewicht haben wollen.
Eine Kultur der Wahrhaftigkeit
Zum Protestantismus gehört neben einem Pathos der Gnade auch ein Pathos der Wahrhaftigkeit, des offenen Wortes, der unangenehmen Schonungslosigkeit mit sich selbst – und der Institution. Die Wahrheit des Evangeliums muss ans Licht, auch wenn kirchliche Dunkelmänner sie lieber unter der Kirchenbank halten würden. Die Treue zur rechten Lehre verbietet es, sich bequem im Haus der Lüge einzurichten. So ging man traditionell gegen katholische oder allzu irenische Versuche vor, dem reformatorischen Aufbruch seine Spitze zu nehmen.
Der Umgang in unseren evangelischen Gemeinden sollte sowohl von der Bereitschaft zur Vergebung als auch von einer tiefgreifenden Skepsis gegenüber allen Versuchen geprägt sein, unbequeme Wahrheiten und Erkenntnisse unter den Teppich zu kehren. Egal, ob das im Interesse einer Amtsperson und ihres Ansehens, der Institution Kirche und ihres guten Rufes oder eines basisgemeindlichen Harmoniebedürfnisses geschieht. Wo solche Motive im Vordergrund stehen, wird Gnade tatsächlich schnell zum allzu praktischen Vergebungsautomatismus.
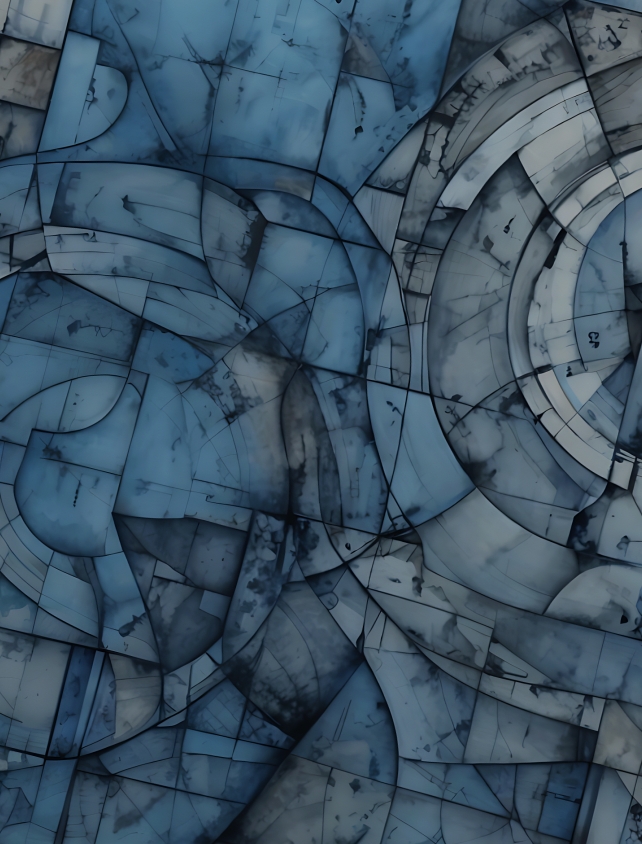
„Broken glass“, produziert mit Playground AI
Zum christlichen Wahrheitsernst gehört dagegen, die theologische Kunst der richtigen Unterscheidungen zu pflegen. Zentral ist die Unterscheidung von Gottes Wort und Wirken einerseits und menschlichem Tun andererseits. Wo wird rituell die Vergebung Gottes zugesagt? Wo wird jemand in einem geordneten Verfahren verurteilt oder freigesprochen? Wo kommt es zwischen einzelnen Menschen zu Vergebung und Versöhnung?
Auf das Schuldbekenntnis im Rahmen einer Beichte – egal, ob im seelsorgerlichen oder im gottesdienstlichen Rahmen –, muss der Vergebungszuspruch folgen, was bedeutet: Gott hat die Beziehung zum Sünder / zur Sünderin von sich aus wieder aufgenommen. Hier besteht kein Interpretationsspielraum für Pfarrerinnen und Pfarrer, auch kein Vorbehalt nachfolgender Wiedergutmachungen. Aber das bedeutet nicht, dass die Gottesbeziehung damit automatisch wieder heil und schon jedes Schuldgefühl verflogen ist.
Vielmehr dürfte die bedingungslose Vergebung in den meisten Fällen erst der Anfang eines Weges sein – so wie das christliche Leben ja allgemein kein Heilsbesitz, sondern ein immer neues Hineinkriechen in die Gnade Gottes ist. Auf diesem Weg, der ja immer gemeinsam zurückgelegt wird, kann es zu Vergebung und Versöhnung unter uns Menschen kommen. Diese Hoffnung sollten wir festhalten. Aber eine Hoffnung ist eben nichts, was man schon wie einen rehabilitierenden Freispruch in die Hand bekommt.
Deshalb ist es unerträglich, wenn eine gnädige Haltung gegenüber Tätern eingefordert, aber diese Gnade gerade den Opfern vorenthalten wird, sobald sie sich gegen eine Vergebungszumutung sperren und unversöhnlich bleiben. So wenig es uns zusteht, mit der Verurteilung und Bestrafung von Tätern eine göttliche Verwerfung zu verbinden, so wenig steht es uns zu, Menschen ihre Unfähigkeit zur Vergebung vorzuhalten. Gerade weil die Vergebung durch Gott keine zusätzlichen Bedingungen außer dem Glauben kennt, gilt für jede echte Vergebung, was auch für den Glauben gilt: Sie ist im Kern ein unverfügbares Geschehen. Sie kann deshalb ersehnt und erbeten, aber niemals einfach zugemutet, eingefordert oder gar durch emotionalen Druck erzwungen werden. Letzteres ist schlicht geistlicher Missbrauch.
Die Spannung zwischen menschlichem und göttlichem Urteil
Praktisch gewendet bedeutet dies: Wir müssen in der Kirche die unterschiedlichen Situationen, in denen Schuld und Vergebung zum Thema werden, möglichst klar auseinanderhalten. Die bedenkliche Harmoniekultur evangelischer Gemeinden dürfte oft mit der Verabsolutierung einer seelsorglichen Perspektive zusammenhängen, die nahezu allen kirchlichen Begegnungen und Situationen übergestülpt wird. Nun unterliegt eine seelsorgerliche Beziehung mit guten Gründen besonderen Regeln, die nicht beliebig auf andere Situationen übertragbar sind. Die Beichte als Ritual der Sündenvergebung, die gottesdienstliche Liturgie und Verkündigung, das kirchenleitende Handeln oder die strafrechtliche Beurteilung von Dienstvergehen folgen alle je eigenen Regeln.
Vergebung meint jeweils etwas anderes im Kontext einer Beichte, in der Vorbereitung auf das Abendmahl oder bei einer Trauerfeier. In einem allgemeinen Fürbittengebet wird man anders sprechen als dort, wo man sich etwa nach einem Gemeindekonflikt gegenseitig verbale Entgleisungen zu verzeihen hat. Überhaupt: Wird ein Schuldbekenntnis nach umfassender Aufarbeitung abgelegt oder vorgreifend angesichts noch bestenfalls ansatzweise aufgeklärter Vorgänge? Wegen einer unbeabsichtigten Verletzung, einer fahrlässigen Unachtsamkeit oder einem schwerwiegenden Vergehen? Hier überall darauf zu pochen, dass quasi-automatische Vergebung eben Christenpflicht und zudem der einzige Weg zum inneren Frieden ist, ist unabhängig von jeder moralischen Bewertung schlicht unprofessionell.
Es ist stattdessen theologisch immer klar zu unterscheiden zwischen dem Beginn und Ziel von Versöhnung. Der erste Schritt muss in der Regel ein Schuldbekenntnis und eine Bitte um Vergebung sein. Ob daraufhin tatsächlich ein Prozess der Vergebung in Gang kommt, ist unverfügbar und kann nicht erzwungen werden. Wenn dieser Prozess zu echter Versöhnung führen soll, braucht das in jedem Fall Zeit. Teilweise können unterwegs juristische Konsequenzen, auch Entschädigungsleistungen oder therapeutische Betreuung erforderlich werden. Manchmal wird die erhoffte Versöhnung – man sollte es einmal so drastisch aussprechen! – sogar den Tod und die Auferstehung aller Beteiligten zur Voraussetzung haben. Im Angesicht Gottes sind Dinge möglich, die uns auf Erden undenkbar und oft auch unerträglich erschienen. Wir haben in bestem Wissen und Gewissen unsere Urteile zu fällen, aber keine ewigen Verwerfungen auszusprechen.
Wenn man aber schon Versöhnung inszeniert, wo überhaupt erst ein Teil der Verfehlungen ans Licht gekommen ist und bestenfalls erste Schritte zur Aufarbeitung geschehen sind, zeigt man nur, dass man diese Spannung zwischen menschlichen und göttlichen Urteilen nicht aushält. Und damit auch, dass man theologisch unverzichtbare Unterscheidungen nicht beherrscht. Unterscheidungen zwischen dem Vorletzten und Letzten, die für das kirchliche Leben kaum weniger bedeutend sind als die reformatorische Rechtfertigungslehre.
Die theologische Debatte – zur Unzeit?
So zeichnen sich theologische Linien ab, um mit den theologischen Anfragen der „ForuM-Studie“ umzugehen. Aber ist die Zeit dafür überhaupt schon gekommen? Direkt im Anschluss an die Veröffentlichung der Studie wurde schließlich nicht nur diskutiert, welche theologischen Einsichten und kirchlichen Praktiken kritik- und reformwürdig sind, sondern ob eine solche theologische Debatte jetzt überhaupt angebracht sei. Handelt es sich bei solchen Diskussionen nicht um die selbstbezügliche Nabelschau einer Institution, in der Betroffenen sexualisierter Gewalt Leid zugefügt wurde und weiter wird?
Diese Kritik verkennt, was auch Kirchenleitungen manchmal zu vergessen scheinen: Theologie ist nicht einfach ideologischer Überbau zur Legitimierung kirchlicher Herrschaft, sondern die selbstkritische Instanz, mittels derer sich die Kirche sich und ihr Handeln überprüft. Einer Kirche, die vollständige Aufarbeitung verspricht, aber das unter Ausklammerung theologischer Probleme erreichen will, ist zu misstrauen.
Sicherlich, ohne die Aufklärung von Tatkontexten und konkrete Fortschritte bei kirchlicher Verantwortungsübernahme und Prävention bliebe diese theologische Diskussion fahrlässiges Gerede, leeres Versprechen. Weil aber die theologische Reflexion kirchlichen Handelns innerlich mit der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt verschränkt ist, kann die Diskussion nicht einfach pausieren, bis die Aufarbeitung in einem ausreichenden Maße fortgeschritten ist. Wer sollte diesen Zeitpunkt auch bestimmen können? Selbst wenn auf der institutionellen Ebene in den kommenden Monaten und Jahren beachtliche Fortschritte erzielt werden, bedeutet dies noch lange nicht, dass die individuellen Aufarbeitungsprozesse der Betroffenen an ein Ende gekommen wären.
Um der Gefahr einer abstrakten Nabelschau oder unsensiblen Prinzipienreiterei zu wehren, sind daher aus reformatorischer Perspektive (mindestens) drei Kriterien theologischer Arbeit zu beachten:
1. Die theologische Reflexion nach Veröffentlichung der „ForuM-Studie“ muss gerade Betroffene als Subjekte ihrer eigenen Geschichte und damit als theologische Gesprächspartner:innen ernstnehmen. Das gilt auch dann, wenn sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen von Glauben und Kirche abgewandt haben.
2. In der notwendigen Differenzierung zwischen einem ethisierenden Schuldbegriff und dem theologischen Sündenbegriff ist die Zurückhaltung bezüglich moralisierender Urteile bereits angelegt. Es verbieten sich theologische Beschämungsdiskurse, die keine Wege aufzeigen, um mit der Scham über individuelle und institutionelle Schuld umzugehen, sondern diese vielmehr verstärken oder gar instrumentalisieren wollen.
3. Die eigenen theologischen Traditionen und liebgewonnene kirchliche Praktiken auf den Prüfstand zu stellen, ist natürlich immer schmerzhafter, als sich distanziert mit den Schwächen anderer Menschen, Kirchen oder Frömmigkeitsstile zu befassen. Uns ist durch die „ForuM-Studie“ kein Aufrechnen und Vergleichen untereinander aufgetragen, das auf durchsichtige Weise nach der eigenen Entlastung sucht. Auch bei theologischer Kritik gilt das an anderer Stelle in der Eule erwähnte bürgerschaftliche Motto: „Grabe, wo Du stehst!“. Sollten wir mitunter den Splitter im Auge der Geschwister, aber den Balken in unserem Auge nicht sehen?
Für die evangelischen Kirchen kann die Herausforderung durch die „ForuM-Studie“ nur bedeuten, auf Grundlage reformatorischer Einsichten und im Gespräch mit der Schrift den neu aufgeworfenen Fragen nachzugehen. Und sich dabei selbst weder zu schonen noch in demonstrative Selbstgeißelung zu verfallen.
Mehr:
- Im Eule-Podcast diskutiert Prof. em. Katharina von Kellenbach mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein über einen neuen Umgang mit Schuld und Vergebung nach der „ForuM-Studie“. Wie kann das „Kompostieren von Schuld“ gelingen – und welche praktischen Folgen kann es in der Kirche haben?
- Ebenfalls im Eule-Podcast gibt Prof. Friederike Lorenz-Sinai, die an der „ForuM“-Studie mitgearbeitet hat, Auskunft über die Frage, was (gute) Aufarbeitung ausmacht. Im Gespräch mit Philipp Greifenstein geht es darum, woran die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche bisher gescheitert ist – und wie sie gelingen kann.
- Welche Strukturen in der evangelischen Kirche und Diakonie haben Missbrauch begünstigt und Täter:innen geschützt? Wie nehmen Betroffene die Strukturen von Kirche und Diakonie – bis heute – wahr? Darüber sprach Safiye Tozdan im Eule-Podcast mit Philipp Greifenstein. Tozdan hat das Teilprojekt D der „ForuM-Studie“ geleitet.
- Alle Eule-Beiträge zum Themenschwerpunkt „Missbrauch evangelisch“.
Unterstütze uns!
Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.

Mitdiskutieren